Im Hochschulvertrag mit dem Senat Berlin wurde 2016 festgelegt, dass alle Universitäten eine Diversity Policy erarbeiten müssen. Durch sie soll sichergestellt werden, dass an Universitäten ein wertschätzender Umgang mit Diversity gepflegt und Diskriminierungen jeglicher Form entgegengewirkt wird. An der Universität der Künste in Berlin ging der Auftrag zur Erarbeitung der Policy für die Hochschule an die Ständige Kommission für Chancengleichheit. Die Mitglieder Tashy Endres, Maja Figge und Claudia Hummel erzählen im Interview von den Zielen und Herausforderungen dabei.
Annina Bachmeier
Wie geht ihr vor, um die Diversity Policy für die UdK zu erarbeiten?
TASHY ENDRES
Wir haben uns innerhalb der Kommission für Chancengleichheit zu einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, der AG Critical Diversity, um den Prozess gezielt und konzentriert voranzubringen. Ihr gehören neben Claudia Hummel, Maja Figge und mir Mathilde ter Heinje, Samara Hammud, Katrin Köppert und Anne Merle Krafeld an. In dieser AG Critical Diversity haben wir in Bezug auf die Policy recherchiert, wie die Policies anderer Universitäten aussehen und daraus einen Anfangsfahrplan erarbeitet. Uns ist aufgefallen, dass es beim Thema Perspektivenvielfalt vor allem wichtig ist, herauszufinden, welchen Bedarf es an der UdK überhaupt gibt. Wir wollen das als hochschulweiten kollektiven Prozess gestalten. Das Thema soll an der Uni in Gesprächen und Diskussionen erörtert werden, so können wir am besten die Bedarfe in den verschiedenen Statusgruppen und Fachbereichen herausfinden und die Problemfelder gezielt benennen.
MAJA FIGGE
Gleichzeitig ist uns wichtig, dass das Thema Diversität und Antidiskriminierung mit der Policy eine Öffentlichkeit und Sensibilisierung erreicht, damit mehr Menschen als nur die Betroffenen darüber reden. Wir haben uns an der UdK mit vielen Menschen vernetzt, die sich mit diesen Themen beschäftigen, unter Anderem dem International Office, dem Studium Generale, der Frauenbeauftragten, der Projektgruppe Intersectional Matter, dem AStA Referat für Interkulturelles und Antidiskriminierung. Mit Ihnen zusammen haben wir einen Rat für Vielfalt und Gleichberechtigung an der UdK gegründet.
Annina Bachmeier
Gibt es konkrete Umsetzungspläne, damit die Inhalte der Policy wirklich in der Universität ankommen und nicht nur Worte auf einem Papier bleiben?
TASHY ENDRES
Gerade haben wir noch keinen kompletten Überblick, über das, was gebraucht wird. Da gibt es noch Lücken, die wir in Gesprächen, vor allem mit den möglichen diskriminierten Gruppen selbst, schließen müssen. Es handelt sich zum Beispiel um Fragen wie: haben Trans-Studierende eine selbstverständliche Zugänglichkeit für die gesamte Universität? Wie viele Professor*innen mit Arbeiter*innenhintergrund gibt es eigentlich an der Universität? Oder wie können Hürden für Studierende abgebaut werden, deren erste Sprache nicht Deutsch ist.
Für uns geht es um Diversität, damit meinen wir aber nicht einen unkritischen “bunten Kessel”oder Management-Konzepte, sondern das Erkennen und Benennen struktureller Diskriminierungen und das Entwickeln von gezielten Maßnahmen dagegen. Als eine konkrete Maßnahme wäre es unserer Überlegung nach sinnvoll, eine Beratungsstelle für Antidiskriminierung einzurichten, an die man sich bei Problemen und Diskriminierungserfahrungen an der UdK wenden kann.
CLAUDIA HUMMEL
Man muss auch bedenken, das wir uns an der UdK als Kunsthochschule, bewusst sein müssen, dass neben den verschiedenen Dimensionen wie Gender, Trans-/Intersexualität, Rassifizierung, sexuelle Identität, Klasse, soziale Herkunft, Behinderung, Alter, Religion, Weltanschauung und Intersektionalität, auch noch weitere Ausschlussmechanismen hinzukommen können. Unreflektierte Kunst- oder Bildungsbegriffe zum Beispiel, die identifiziert werden müssen.
Annina Bachmeier
Was kann man sich unter einem unreflektierten Einsatz von Kunstbegriffen vorstellen?
CLAUDIA HUMMEL
In der Schweiz gibt es die Studie Art School Differences. An drei Schweizer Kunsthochschulen wurde erforscht, welche Diskriminierungsformen an den Kunsthochschulen eine Rolle spielen können. In Bezug zu Aufnahmeprüfungen für Musikstudien hat sich beispielsweise herausgestellt, dass Menschen, die in einem musikalischen Raum aufgewachsen sind, in dem man sich nicht, wie in Europa, an der Zwölftonleiter orientiert, viel leichter durch die Prüfungen für Gehörbildung fallen, weil sie sich musikalisch in einem anderen Kontext bewegen. Sie können dafür Vierteltöne hören, die viele Europäer*innen nicht gelernt haben zu hören. Da taucht eine eurozentristische Idee von Fähigkeit im Bereich Musik auf, die für alle Leute, die in einem anderen musikalischen Raum als dem europäischen sozialisiert wurden, diskriminierend ist.
MAJA FIGGE
Allgemein sind diese Aufnahmeverfahren an den Kunsthochschulen von einem Begabungsbegriff geprägt, der von eurozentrischen Grundsätzen und Vorstellungen ausgeht, die nicht immer hinterfragt werden. Wie und auf welcher Grundlage soll gemessen werden, wer begabt ist und wer nicht? Dadurch würden in Zukunft die Aufnahmeprozesse vielleicht neu gestaltet werden.
Annina Bachmeier
Welche Ansätze gibt es, um Personen aus minorisierten Gruppen zu erreichen, denen es oft an Selbstbewusstsein fehlt, sich an Kunsthochschulen wie der UdK überhaupt zu bewerben?
CLAUDIA HUMMEL
Dabei spielt der Auftritt der UdK nach außen eine große Rolle. Wo taucht die UdK auf, in welchem Kontext, welcher Bild- und Sprachpolitik bedient sie sich bei ihrem Auftritt. In welchen Räumen finden Begegnungen statt, wie und wo können Schüler*innen erfahren, dass man an der UdK studieren kann. Das muss in den Maßnahmen für Diversität noch weiter ausgebaut werden.
TASHY ENDRES
Die Kommunikation nach außen und damit das Anziehen diverserer Bewerber*innen muss mit einem diskriminierungssensiblen und immer wieder neu zu reflektierenden Auswahlverfahren einhergehen. Wenn wir Leuten vermitteln, dass sie Chancen haben, der Auswahlprozess aber nicht die entwickelten Grundsätze aus der Policy Struktur übernimmt, ist das auch wieder problematisch.
MAJA FIGGE
Es ist wichtig, dass bei den Lehrenden, Professor*innen und wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter*innen eine aktivere Suche nach einer inklusiveren Einstellungspolitik stattfindet. Sodass die Studierenden überhaupt Leute haben, mit denen sie sich identifizieren können, die ihre eigene Geschichte repräsentieren. Ziel wäre, dass sich die gesamte Gesellschaft in der Kunsthochschule widerspiegelt, nicht nur ein kleiner privilegierter Teil.

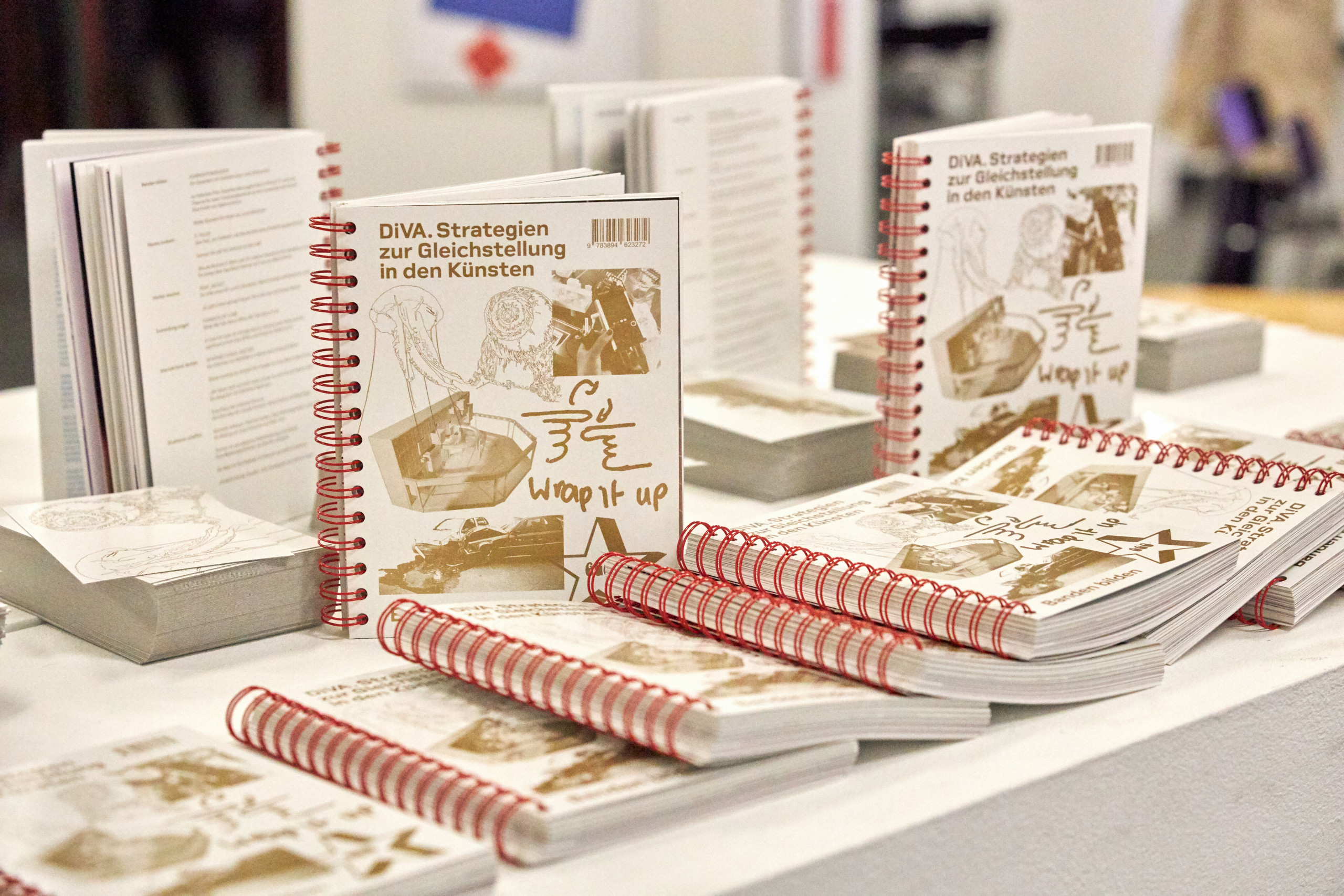
One thought on “Eine Policy für wirkliche Chancen”