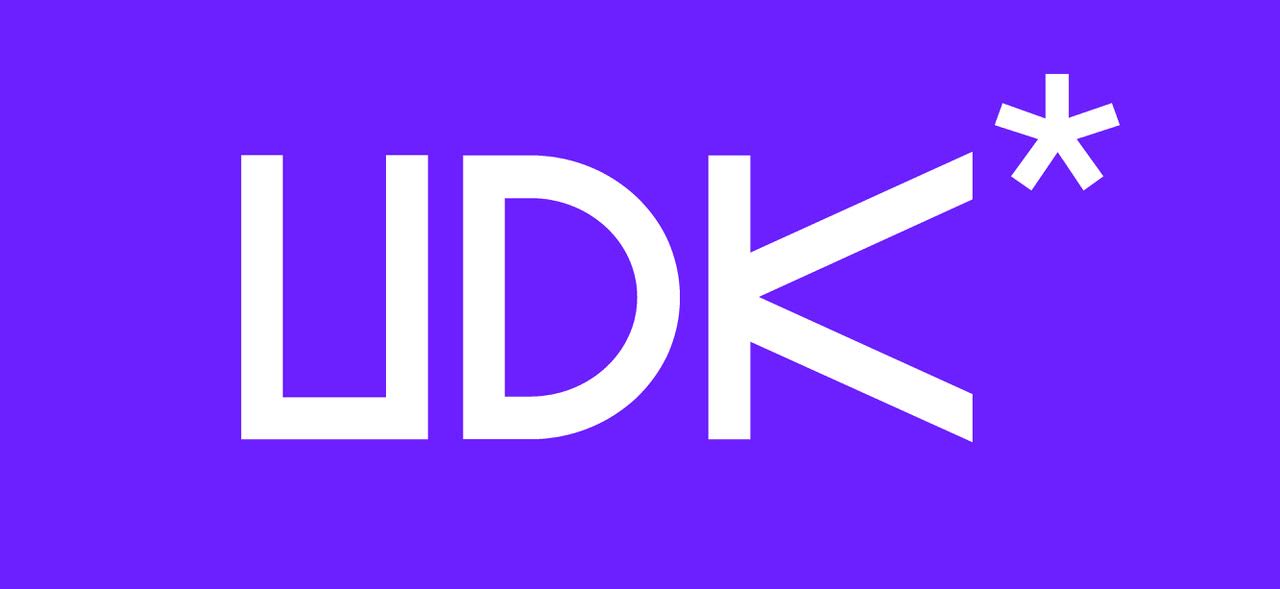Das allgemein etablierte, binäre Geschlechtersystem geht von der Alleinexistenz zweier klar bestimmbarer Geschlechter – nämlich Männer und Frauen – aus und entspricht damit nicht ansatzweise der eigentlichen menschlichen Vielfalt. Auch die deutsche Sprache spiegelt diese konstruierte Zweigeschlechtlichkeit wider, wenn z. B. von „Studentinnen und Studenten“ oder von „Professorinnen und Professoren“ die Rede ist und macht Frauen und Männer damit gleichermaßen sichtbar.
Hier muss ich kurz ausholen, denn selbst das ist leider noch längst nicht überall gang und gäbe, war und ist ein andauernder Kampf, um die Sichtbarkeit von Frauen im deutschen Sprachgebrauch und damit auch in den Bildern, die wir mit Gelesenem und Gehörtem zwangsläufig assoziieren. Auch an unserer Hochschule gibt es noch immer Professor*innen, die konsequent das generische Maskulinum verwenden und damit mehr als die Hälfte ihrer Studierenden nicht ansprechen (von anderen Kämpfen um die Rechte Frauen mal ganz zu schweigen; Stichworte Gender Pay Gap oder Frauenanteil in Führungspositionen. Und wie kann es sein, dass Fahrzeuge oft nur mit “männlichen“ Crash-Test-Dummies, Medikamente überwiegend an cis männlichen Probanden getestet werden und dementsprechend für Frauen ungleich unsicherer sind?).
„Immerhin“, möchten wir jetzt vielleicht sagen, „bewegt sich was, zumindest sprachlich.“ Was wir aber nicht vergessen dürfen: Selbst mit diesen Formen und trotz all dieser Diskurse bleiben weiterhin Menschen ausgeschlossen; nämlich all jene, die sich nicht als Frau oder als Mann identifizieren. Das kann trans, inter und nichtbinäre Personen betreffen. Die Genderforschung argumentiert schon seit Jahren, dass dieses binäre System nicht mehr haltbar ist und von einer Vielzahl geschlechtlicher Identitäten ausgegangen werden muss. Die Lebensrealitäten aller Geschlechter sollen ausgewogen berücksichtigt, Rollenklischees nicht weiter verfestigt werden. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom September 2017 schließt das auch explizit Geschlechtsidentitäten von inter und trans Personen mit ein. Gendersensible Sprache und Inhalte haben die Vision, die gesamte Vielfalt unterschiedlicher Lebensrealitäten selbstverständlich sichtbar zu machen: nicht nur von Menschen unterschiedlichen Geschlechts, sondern auch unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Religion, Herkunft und Hautfarbe. Gendersensible Sprache ist ein weiterer Schritt in Richtung diversitätssensible Welt.
Die UdK Berlin hat im vergangenen Monat auf gemeinsamen Antrag des StuPa, des AStA, der Kommission für Chancengleichheit und der Frauenbeauftragten beschlossen, sich dieser Problematik verstärkt zu widmen und diskriminierende Strukturen sukzessive abzubauen. So werden in den kommenden Wochen folgende Umstellungen in Angriff genommen:
- Integration und Anerkennung aller nichtbinären Geschlechteridentitäten und Personen mit allen Varianten der Geschlechtsentwicklung durch eine Ergänzung der Optionen „divers“ und „keine Angabe“ sowie die Verwendung neutraler Anreden, Formulierungen und des Gendersternchens in allen universitären Korrespondenzen, Dokumenten, Formularen, Zeugnissen, Statistiken, Datenbanken und auf allen Plattformen der UdK Berlin.
- Einführung von bis zu 50% genderneutraler Toiletten an allen Standorten der UdK Berlin Immer wieder machen inter, trans und nichtbinäre Mitstudierende diskriminierende und sogar gewaltvolle Erfahrungen bei der Wahl ihrer Toilette. Ein menschliches Grundbedürfnis zu stillen, darf nicht zu einer immer wieder diskriminierenden Erfahrung werden; in unserer Gesellschaft müssen alle Menschen ein diskriminierungsfreies Leben führen dürfen. Eine „Toilette für alle“ bietet den Betroffenen den nötigen Schutzraum, trägt der geschlechtlichen Vielfalt Rechnung und zu einer Kultur des Respekts und der Antidiskriminierung bei. (Wegen unterschiedlicher Bedürfnisse nach Schutzräumen sollen weiterhin Frauen- und Männer-Toiletten bestehen bleiben. So wird gewährleistet, dass alle Menschen ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend eine Toilette als sicheren Raum betreten können.)
- Anerkennung und Integration des selbst gewählten Vornamens unter Anwendung des vom BMI anerkannten dgti-Ergänzungsausweises auf Studierendenausweisen, bei der Zulassung, im Studienverlauf, auf Zeugnissen und Diplomen. Ein Zwangs-Outing gegenüber Professor*innen und Mitstudierenden wird so aufgehoben und der psychische und emotionale Druck verringert. (Von einem Zwangs-Outing ist z.B. dann die Rede, wenn der dead name (der bei der Geburt zugewiesene, nicht mehr verwendete Name) beim Verlesen von Teilnahmelisten oder beim Vorzeigen des Studierendenausweises genannt wird, Stellungnahme der Antidiskriminierungsstelle des Bundes) Eine Studie der Universitäten Texas, British Columbia und NYU zeigt: Bei jungen trans Menschen tritt ein deutlicher Rückgang depressiver Symptomatik sowie eine Reduktion ihres suizidalen Verhaltens um 56% ein, wenn sie in einem ihrer Lebensumfelder mit ihrem gewählten Vornamen angesprochen werden.
Die UdK ist berlinweit die erste Universität, die diesen wichtigen Schritt geht und damit dem Vorbild zahlreicher anderer deutscher Universitäten folgt. Bleibt zu hoffen, dass dieses Vorbild Schule macht.
Denn: Universitäten sind Orte des Lernens, Räume der Entwicklung, in ihnen sollen sich Gedanken und Persönlichkeiten frei entfalten können; sie tragen deshalb eine massive Verantwortung für den Schutz ihrer Angehörigen. Dass diese Schutzräume, gerade an Kunsthochschulen, wichtig sind, damit sich alle unsere Kommiliton*innen mit Vertrauen und (angst)frei bewegen und ausprobieren können, muss hier vermutlich nicht weiter erläutert werden.
Ich stoße mich grade selber an dem Begriff „Schutzraum“ in diesem Zusammenhang, denn eigentlich bräuchten wir natürlich mehr als das; eine uns bedingungslos schützende Gesellschaft – sodass dezidierte Schutzräume hinfällig werden können.
Aber da sind wir noch nicht. Und dahin kommen wir auch nur, wenn wir beginnen, jahrhundertealte Denkmuster und Machtstrukturen unserer konstruierten „Mehrheitsgesellschaft“ zu erkennen, sie aufzubrechen und uns ihrer zu entledigen.
Am Ende betrifft es uns alle. Nicht umsonst leitet sich das Wort Kommiliton*in vom lat. commilito ab: „Mitstreiter*in“ also. Miteinander für etwas streiten. Oder füreinander mitstreiten – gelegentlich vielleicht sogar über etwas streiten, im Sinne eines konstruktiven Streits in Kunst und Wissenschaft – all das geht nur in einem Klima des Vertrauens und gegenseitigen Respekts.
Diskriminierungsherde sind aber weiterhin da – vielen Nichtbetroffenen bleiben sie auf den ersten Blick verborgen; viele Betroffene sind direkt mehrfach betroffen. Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Ableismus, Klassismus, Ageismus – die Liste ist lang und nicht mit dreieinhalb Forderungen zur Gendergerechtigkeit abzuhaken. Denn solange auch nur eine einzige Person innerhalb jeweiliger Strukturen Diskriminierung(en) erfährt, ist schützender Raum nicht in ausreichendem Maße gegeben.
In diesem Sinne: Wir danken dir, UdK Berlin, für diesen Schritt in die richtige Richtung. Das hier ist ein Anfang. Aber, UdK, es geht weiter – versprochen? Wir hören uns ganz bald wieder!