Die Zine zu Unlearning University ist erschienen.
Unlearning_University_Zine (PDF)

Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.
„Ihr dachtet, ich hätte nichts zu sagen. Wie denn auch? Das hier, das ist nicht mein Raum“1clashing differences (Regie: Merle Grimme, Deutschland 2023) – Zitat aus der Serie Clashing Differences
Merle Grimme ist eine deutsche Schwarze Regisseurin, Drehbuchautorin und Producerin. Seit über 16 Jahren hat sie in unterschiedlichsten Filmdepartments gearbeitet, wobei sie immer wieder mit Diskriminierung konfrontiert wurde. An der Filmhochschule München war sie die einzige Schwarze Person ihres Jahrgangs. Nicht selten fehlte ihr ein Raum, um über diese Erfahrungen zu sprechen. Heute hilft sie dabei neue Strukturen im Film zu schaffen, um genau das zu verändern.
Machtkritische Ansätze in der Kulturszene werden bei dem Paneltalk „Handwerkszeug: Aufbau einer Diversitätsinfrastruktur in Theaterinstitutionen“ am ersten Tag des Symposiums Unlearning University diskutiert. Neben der Regisseurin Merle Grimme, waren die Intendantin Julia Wissert und die Theaterwissenschaftlerin Joy Kalu eingeladen. Alle drei sind Schwarze Frauen die sich neben ihrer Arbeit auch als Aktivistinnen gegen Diskriminierung in verschiedenen Sektoren der Kulturwelt einsetzen und klare Lösungswege bieten um sichere, diversere Räume zu schaffen. Im Paneltalk erzählen sie von Erfahrungen mit Diskriminierung, die sie auf ihrem Werdegang täglich erlebt haben, von ihrem aktivistischem Einsatz, um genau diese Dinge in der Zukunft zu verhindern und von ihren Erfolgen sowie Misserfolgen.
Sie kritisiert, dass sie in der Vergangenheit oft auf Paneltalks eingeladen wurde, um – unausgesprochener Weise – die Diversitätsquote zu erfüllen. Sollte es dabei nicht um ihre Arbeit und Kenntnisse gehen?
Genau diese und andere intersektionale Diskriminierungen und Vorurteile, die auch innerhalb von politisch-feministischen Aktivist*innen Kreise stattfinden, thematisiert sie in ihrer, von ARD und ARTE produzierten, Miniserie Clashing Differences.
In der Serie planen drei weiße Frauen einer feministischen Organisiation einen Panel Talk in Brandenburg. Nachdem ihnen auffällt, dass sie keine schwarze Frauen, Queere Personen oder Menschen mit Behinderungen eingeladen haben, wollen sie schnell für Vielfalt sorgen.
Kurzfristig wird eine Gruppe von queeren BIPOC Personen eingeladen, um die Konferenz zu diversifizieren. Dabei kommt es zu „clashes“ – das aufeinandertreffen verschieden diskrimierter Person bedeutet nämlich nicht, dass alle dieselben Erfahrungen machen und die selbe Diskriminierung erleben. Es geht um intersektionale Vorurteile, beschreibt Probleme innerhalb der linken Blase und ermutigt sich immer wieder neu zu begegnen und in den Dialog zu treten.2Vgl.: Interview mit Merle Grimme (2023), Moderation: Tom Westerholt, Deutschlandfunk Nova, URL: … Mehr anzeigen
An der Deutschen Filmakademie entwickelt Merle seit 2023 ein anitdiskriminierendes Herstellungskonzept durch die Etablierung von critical whiteness workshops, empowerment trainings, diskriminierungssensible Vertrauenspersonen am Set und ein divers besetztes Team wie auch Cast.
In Filmproduktionen besteht immer noch eine starke Hierarchisierung in den Strukturen und viel Zeitdruck. Wo bleibt da der Raum, um über Diskriminierungserfahrungen zu sprechen? Beim Film kostet jede Minute, und um diesen Disskusionsraum zu schaffen wird während der Dreharbeiten zusätzliche Zeit, und somit Geld, beansprucht. Ist es das Wert? Nach Merles Erfahrung ist er nicht nur notwendig, sondern auch Hilfreich. Sichere Räume zu schaffen sollte kein Extra sein, sondern dazu gehören.
Personen die sich in den alten Strukturen der Leitungsebenen von Filminstitutionen bewegen, erkennen nicht von alleine die Notwendigkeit und Wichtigkeit von Veränderung. Merle erzählt, wie sie trotz gehäuften Widerspruch für untypische, aber wichtige zusätzliche Positionen auf ihrem Set als Bedingung bestanden und gekämpft hat, um Strukturen zu schaffen, in denen sie sich selbst bewegen will.
Sichere Räume am Film schaffen – wie?
1. Damit Diskriminierung nicht unsichtbar bleibt, ist es wichtig, am Set eine Vertrauensperson zu haben, an die sich alle mitarbeitende Personen wenden können. Das soll einen sicheren Raum schaffen, in dem es trotz stressiger Arbeitsbedingungen möglich bleibt, Unwohlsein, Diskriminierungen innerhalb der Crew und Bedürfnisse mitzuteilen.
2. Um Regeln klar zu definieren, lässt sich mit einer angepassten Version der Antirassismusklausel arbeiten. Ihr Ziel ist es, dass betroffene Personen sich nicht alleingelassen fühlen, rassistische Äußerungen thematisiert werden und zur Selbstverantwortung verpflichten. Diese von Julia Wissert (Regisseurin und Intendantin Schauspiel Dortmund) und Sonja Laaser (Rechtsanwälting und freie Dramaturgin) aufgesetzte Vertragsvorlage soll Kulturschaffenden als Werkzeug dienen, um alte Strukturen im Kultursektor zu verändern. Basierend auf der Definition von Rassismus nach dem Artikel 1 des „Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung“ wird ganz klar Rassismus am Arbeitsplatz definiert:
„In diesem Übereinkommen bezeichnet der Ausdruck „Rassendiskriminierung“ jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben von Menschenrechten und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.“
– Artikel 1, Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung3Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966, Quelle: Bundesgesetzblatt (BGBL) 1969 II, Seite 961, URL: … Mehr anzeigen
„Eine Äußerung gilt als rassistisch, wenn sich eine an einer Produktion beteiligte Person von einer Äußerung durch Mitarbeitende betroffen fühlt, welche einen Bezug zu der in der Klausel verankerten Definition von Rassismus hat. (…) Sollten sich Theater und der/die Betroffene über den Bezug von Äußerung und Rassismus streiten, könnte dieser Streit von Gerichten entschieden werden.“
– aus dem Hintergrund und Zielrichtung der Antirassismusklausel4Sonja Laaser et al., „Ziele der Antirassismusklausel“, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: … Mehr anzeigen
Gleichzeitig werden klare mögliche Konsequenzen genannt im Falle einer rassistischen Äußerung. Diese sind zum Beispiel Konfrontation mit Mediation, Empowerment für die betroffene Person oder Workshops (ohne involvieren der betroffenen Person).5Vgl.: Formulierungsvorschläge: Antidiskriminierungsklausel, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: … Mehr anzeigen
3. Gemeinsame somatische Körperkurse am Set vor Drehbeginn dienen nicht nur dem Empowerment, sondern auch dazu, Hierarchien aufzubrechen, indem durch das gemeinsame Bewegen alle Crew Mitglieder sich kennenlernen und auf Augenhöhe begegnen. Regiesseur*in und Set-Runner lernen sich zum Beispiel kennen und ein neues, entspannteres, friedliches Miteinander entsteht.
4. Workshops zur Aufklärung über intersektionale Diskriminierung werden veranstaltet, um Bewusstsein zu schaffen und sichere Räume zu bauen.
Merle berichtet über die positiven Auswirkungen durch die Implementierung dieser Bedingungen. Statt dem der Produktionsfirmen befürchteten Zeitverlust bemerkt sie, dass die Menschen am Set nach gemeinsamen Übungen viel konzentrierter, präsenter und dadurch effizienter arbeiten können.
All diese Lösungsansätze wurden von POC erarbeitet, um Veränderung zu schaffen. Das ist aufwendige zusätzliche Arbeit, um Probleme zu lösen, die sie nicht geschaffen haben. Genau das muss verändert werden. Diese Veränderungen müssen gemeinsam erkämpft werden.
Merle setzt auf die neue Generation von Filmschaffenden. Darauf, dass ein Erfahrungsaustausch stattfindet, für sichere Räume gesorgt wird, dass besser darauf geachtet wird, wer in der Filmbranche Sichtbarkeit erfährt und welche Stimmen gehört werden.
Es liegt ein großer Unterschied darin sich theoretisch kritisch auseinanderzusetzen oder dann tatsächlich umzusetzen. Es braucht einen gezielten Dialog – und noch viel wichtiger – ein Zuhören. Dabei reichen nicht nur Verständnis und Haltung von weißen Menschen gegen intersektionale Diskriminierungen, sondern benötigt gezielte Handlungen; Betroffene dürfen nicht alleingelassen werden, mit der Aufgabe sichere Räume zu schaffen. Sie müssen darin Unterstützt werden, auch von Menschen die nicht direkt betroffen sind. Eine Möglichkeit wäre das Durchsetzen von verpflichtenden Konsequenzen für rassistische Äußerungen am Arbeitsplatz, zb. durch Implementierung der Antirassismusklausel.
Um Problembewusstsein zu schaffen, müssen alle Kulturschaffende es priorisieren sichere Räume zu schaffen, ein Miteinander in dem über Erfahrungen gesprochen werden kann, in denen Zugehört wird, in denen Konsequenzen klar formuliert sind. Gerade in den alten Strukturen von Filmproduktion finden die Bemühungen oft keinen notwendigen Stellenwert, deshalb braucht es eine neue Generation die sich einsetzt, aktiv Einschreitet und bereit ist sich gemeinsam immer wieder neu zu begegnen. Diese Arbeit ist kein Selbstläufer und um Veränderung zu schaffen, muss immer wieder neu argumentiert werden.
Zusätzliche Quellen:
https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/update-vertraege-anti-rassismus-anti-diskriminierungs-musterklausel
https://www.casting-network.de/beitraege/cn_klappe_29_09_2023_857.pdf
https://www.zdf.de/serien/clashing-differences
https://www.zdf.de/serien/clashing-differences/making-of-clashing-differences-at-102.html
Referenzen
| 1 | clashing differences (Regie: Merle Grimme, Deutschland 2023) |
|---|---|
| 2 | Vgl.: Interview mit Merle Grimme (2023), Moderation: Tom Westerholt, Deutschlandfunk Nova, URL: https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/zdf-serie-clashing-di%EF%AC%80erences-filmemacherin-merle-grimme-ueber-diversitaet-in-filmen-und-serien (letzter Zugriff: 19.03.2025) |
| 3 | Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung vom 7. März 1966, Quelle: Bundesgesetzblatt (BGBL) 1969 II, Seite 961, URL: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICERD/ICERD_Konvention.pdf |
| 4 | Sonja Laaser et al., „Ziele der Antirassismusklausel“, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/ziel-der-antirassismusklausel (letzter Zugriff: 19.03.2025) |
| 5 | Vgl.: Formulierungsvorschläge: Antidiskriminierungsklausel, auf der Website der Kanzlei Laaser, URL: https://www.kanzlei-laaser.com/wissenspool/beitraege/update-vertraege-anti-rassismus-anti-diskriminierungs-musterklausel |
Über drei Tage versammelte das Symposium Unlearning University, fakultätsübergreifend organisiert von Lehrenden, Studierenden sowie Beauftragten für Diversität und Barrierefreiheit Stimmen für eine diskriminierungskritischere Kunsthochschule im Medienhaus der UdK Berlin. Themen sind Zugänge zum Studium an der Kunsthochschule, Prozesse der Kanonisierung und die damit verbundene Notwendigkeit der Kanonkritik. Es wird danach gestrebt, neue Wege des Lernens und Lehrens zu erkunden. Doch was bedeutet es für die Kritik der traditionellen Bildungsinstitution, wenn diese Kritik in den Räumen der Institution selbst geübt wird? Es stellt sich die Frage, wie voreingenommen Räume sein können. Wie beeinflussen Räume Emotionen, Verhalten und Lernprozesse. Kann in denselben Räumen gelernt und verlernt werden?
Kunsthochschulen sind exklusive Räume. Hiermit meine ich nicht die Art von Exklusivität, die Sophie Vögele in der Studie Art.School.Differences beschreibt – in der Studie geht es um die Frage, wer zum künstlerischen Studium zugelassen wird und wer nicht.1Vögele, Sophie / Saner, Philippe (Hg.): Art.School.Differences., Zürich 2022 Mir geht es um den physischen Raum: Um das Gebäude betreten zu können, muss an der Pforte geklingelt und es muss Einlass gewährt werden. Dies gilt sowohl für Student*innen als auch Besucher*innen. Die Kunstuniversität ist kein Raum, durch den sich frei bewegt werden kann, sondern einer, der überprüft wird und dessen Zugang nur selektiv gewährt wird. Hat man es einmal in das Gebäude geschafft, fällt der Blick auf die Inneneinrichtung. Geschmackvolle Designerstühle und industriell anmutende schwarze Tische in den Unterrichts- und Arbeitsräumen situieren diesen Ort, im Gegensatz zu einer sonstigen Bildungseinrichtung, klar als Kunsthochschule, die sich wiederum in einem westlichen Designkanon verortet. Dabei ist das Darstellen von Geschmack immer auch Ausdruck von kulturellem Kapital2DiMaggio, Paul: „Classification in Art.“, in: American Sociological Review, Bd. 52, Nr. 4, 1987, S.440–455.. Die richtigen Referenzen zu kennen wird vom Mobiliar geradezu vorausgesetzt – und damit auch eine spezifische Klassenzugehörigkeit.
Das Gebäude an sich demonstriert seine Rolle durch die schiere Größe, sein Alter und der damit verbundenen Geschichtsträchtigkeit. Es beansprucht eine gewisse Ehrfurcht und Seriosität für sich. Eine Forderung, die beim Durchschreiten der Räumlichkeiten mit dem Nachhallen jedes einzelnen Schritts deutlich spür- und hörbar wird.
Die Veranstalter*innen des Symposiums haben sich bemüht, die Universität durch eine Reihe von Raumtransformationen und -erweiterungen aus ihrem gewohnten Modus zu befreien. Der Alltag an der Bildungsinstitution ist geprägt von ritualisierten Abläufen an immer denselben Orten, die über die Zeit hinweg durch Wiederholung zu einem festen Bestandteil der studentischen Erfahrung werden. Ich frage mich, inwiefern es möglich ist, diese bestehenden Erfahrungen beiseite zu lassen und so Platz für etwas Neues zu schaffen. Obwohl der Veranstaltungsort vermutlich nicht mit der bewussten Entscheidung gewählt wurde, dass dies genau der richtig Raum für diese Konferenz sei, sondern viel mehr aus praktischen Gründen, beeinflusst er doch, welche Art von Aktionen überhaupt möglich sind. Oder wie es der Philosoph und Soziologe Henri Lefebvre darstellt: „Activity in space is restricted by that space; space ‚decides‘ what actually may occur, but even this ‚decision‘ has limits placed upon it.“3Lefebvre, Henri: The Production of Space, Oxford 1991 [zuerst Paris 1974], S.143 Räume sind demzufolge nicht nur Kulissen, sondern Akteure für das soziale Leben, die Wege eröffnen oder blockieren.
In der Aula des Medienhauses, dem Hauptveranstaltungsort des Symposiums, auf den ich mich für meine Argumentation beziehe, finden normalerweise Vorlesungen oder auch der Semesterauftakt statt. Unzählige Male habe ich hier schon gesessen. Diesmal soll jedoch vieles anders werden: Die Sprechenden unterscheiden sich von denen, die ich hier zuvor gehört habe, und auch der Raum sieht anders aus. Die Reihen der üblichen grauen Hartschalen-Stühle sind durchsetzt von bunten Sofas und Sitzsäcken, auf denen jeweils eine Handvoll Personen Platz finden. Im hinteren Teil des Raums wurde ein Tisch mit einer Decke versehen und zum Buffet umfunktioniert, an dem warme Getränke und Kleinigkeiten zu Essen angeboten werden. Gegenüber wurde eine Leseecke installiert. Auf einem aus hellem Holz gefertigten Podest wird Literatur bereitgestellt, die zum Thema der Veranstaltung passt. Die Aula ist auf Frontalpräsentationen ausgelegt; es geht hier um den Fokus von vielen auf eine kleine Gruppe, was sich auch in Beleuchtung und Akustik spiegelt, nicht darum, sich gegenseitig zuzuhören. Dies wird jedes Mal aufs Neue klar, sobald eine Person aus dem Publikum versucht, an dem Gespräch vorne teilzunehmen. Die Rauminterventionen erweitern zwar den Horizont an Möglichkeiten zum gegenseitigen Austausch, doch die grundlegende Ausprägung der Räumlichkeiten kann nicht überwunden werden. Hinzu kommt der symbolische Raum, dessen Bedeutung, selbst wenn die physische Struktur verändert wird, andauert. Was ich unter dem symbolischen Raum verstehe, möchte ich anhand der Positionen von zwei Denker*innen im Folgenden konkretisieren.
In der Phänomenologie beschreibt Edmund Husserl, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und wie diese Wahrnehmung unser Verständnis von Realität formt, anhand eines Tisches, dessen Betrachtung nicht einfach nur ein passiver Prozess sei, bei dem wir lediglich die äußeren Eigenschaften des Tisches registrieren. Husserl beschreibt seine haptische Wahrnehmung beim Berühren des Tisches: „Die Hand liegt auf dem Tisch. Ich erfahre den Tisch als ein Festes, Kaltes, Glattes.“4Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philoso-phie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (ca. 1913) in: Husserliana Bd. IV, hg. … Mehr anzeigen, womit er die Verbindung zwischen Körpern und Objekten verdeutlicht. Die Sinneswahrnehmung der Hautoberfläche zeigt, dass das Empfinden nicht im Objekt oder im Körper liegt, sondern erst als Effekt der Begegnung Form annimmt. Husserl beschreibt das Aufeinandertreffen als eine unumgängliche Verbindung zwischen dem Körper und seiner Umgebung. Oder anders ausgedrückt: Die Räume, in denen wir uns aufhalten, werden auch ein Teil von uns; wir formen und werden geformt.
Zusätzlich möchte ich Überlegungen von Sara Ahmed, einer bekannten Theoretikerin der queeren und intersektionalen Studien, hinzuziehen, in denen sie unter anderem den Prozess der Konditionierung untersucht: „[…] what we ‚do do‘ shapes what we ‚can do‘.“5Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, New York 2006, S. 59 Ähnlich einem Muskel, der immer wieder dasselbe tut und mit den gleichen Aufgaben und Anstrengungen konfrontiert ist, diese im Laufe der Zeit leichter fallen werden. Anforderungen hingegen, die nicht trainiert werden, werden verlernt oder sind nur schwer zu meistern. Ein weiteres Beispiel könnte eine rechtshändige Person sein, die versucht mit ihrer linken Hand zu schreiben. Was wir tun begünstigt, was wir in Zukunft tun werden. Oder: Was wir denken begünstigt, was wir in Zukunft denken werden.
Ergänzen wir die Ausführungen von Ahmed und Husserl, so können wir schlussfolgern, wie groß der Einfluss und wie bestimmend die Wechselwirkung zwischen unseren Körpern und ihrer Umwelt ist. In einem ersten Schritt geht der Körper eine Symbiose mit dem Raum ein, in dem er sich befindet, entsprechend der Schilderung von Husserl – ein unbewusster Prozess. Dieser entscheidet nun mit, wie wir uns durch den Raum bewegen, wie wir ihn wahrnehmen, aber auch was wir empfinden. In einem zweiten Schritt führt die Repetition, so drückt es Ahmed aus, zu einer Art Gewöhnung, die sich in unserem Körper speichert und zukünftige Erfahrungen prägt.
Von diesem Punkt an entsteht eine Spirale. Vergangene und zukünftige Erfahrung werden in einen Prozess der Angleichung versetzt. Was wir im Kontext eines Raums erlebt haben, werden wir in diesem wieder erleben. Konkludiert werden kann demgemäß, dass bestimmte Räume auch immer nur bestimmte Aktionen und Emotionen zulassen. Infolgedessen sind Räume nicht neutral; sie spiegeln Machtverhältnisse wider. Insbesondere in etablierten Bildungseinrichtungen wie Universitäten kommen solche Strukturen im physischen Raum zum Ausdruck und die Räumlichkeiten werden zu Trägern symbolischer Eigenschaften.
In Anbetracht der Theorien wird mir deutlich, weshalb es für mich, der mit den Räumlichkeiten der Veranstaltung so vertraut ist, so schwerfiel, die Trennung zwischen dem physischen und symbolischen Raum vorzunehmen. Die Räumlichkeiten sind fundamental mit der Darstellung sowie der Reproduktion von Normen, Hierarchien und Machtstrukturen verbunden – mit all dem, was während des Symposiums in Frage gestellt wurde. Mir wird klar, warum die durch das veränderte und ergänzte Mobiliar suggerierte lockere Atmosphäre fehlplatziert auf mich gewirkt hat. Es war wie ein Zwiegespräch zwischen dem Bestehenden, aufgeladen durch jahrelange Erfahrungen, und dem Hinzugefügtem, bei dem keine der Parteien die Andere zu übertrumpfen vermochten.
Dass eine Aneignung von Räumen in einem gewissen Maße möglich ist, möchte ich in keinem Fall abstreiten. Beispielhaft hierfür sind im Medienhaus der UdK Berlin die All-Gender-Toiletten bzw. die Beschilderung dieser. Sie sind mit selbst gestalteten, nicht stereotypen Piktogrammen ausgezeichnet.6Durch das Gebäudemanagement wurden inzwischen professionell gestaltete Piktogramme angebracht. Das Leitsystem weist aber immer noch ausschließlich binäre WCs aus; es bleibt eine ewige Transition. Trotz aller Bemühungen um Raumtransformationen hängt neben dem Eingang ein Schild, das die Sanitärräume in das binäre Geschlechtersystem aufteilt. Von einer vollständigen Umstrukturierung oder Eroberung des Universitätsraums kann folglich kaum die Rede sein. Dies bedeutet nicht, dass solche subversiven Eingriffe das alltägliche Leben an der Hochschule nicht bereichern können oder dazu beitragen, das vorherrschende Machtgefälle zu destabilisieren. Jedoch kann es im Licht meiner Betrachtung nicht als Überwindung des gegebenen Raums betrachtet werden; vielmehr als ein Verhandeln mit diesem.
Womöglich wäre ein dritter Ort, sprich: ein Ort ohne Verbindung zur Bildungsstätte, zu Arbeit oder Familie passender als Veranstaltungsort des Symposiums gewesen. Ein Raum, der unbefangen ist von hartnäckigen vorherigen Eindrücken und sich auf diese Weise durch den Austausch gestalten lässt. Ein Raum der Gestaltungsfreiheit bietet.
Die Teilnahme am Symposium Unlearning University hat mir ermöglicht, die komplexe Beziehung zwischen Raum und Machtstrukturen zu untersuchen. Dabei musste ich feststellen, dass keine der Rauminterventionen, die im Zuge der Tagung installiert wurden, die vorhandenen Räume grundlegend transformieren und somit keine neue, unbeschwerte Lernumgebung schaffen konnte. Ich möchte mich an dieser Stelle auf die Philosophin und Professorin an der Akademie der bildenden Künste Wien, Ruth Sonderegger, beziehen, die ihre Präsentation mit einem Zitat von Sharon Stein beendete, welche den Prozess des Wandels hin zu einer ethischeren Institution als „hospicing“7Stein, Sharon et al.: „Gesturing Towards Decolonial Futures: Reflections on Our Learnings Thus Far.“ Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), Bd. 4, Nr. 1, S. … Mehr anzeigen, also als eine Art Sterbehilfe, beschreibt. Ein möglichst sanftes Ende, das Platz für Neues schafft. Mir ist klar geworden, dass dies gleichermaßen für die physischen Räume der Institution gilt. Nicht ohne Grund sagen wir, dass wir aus Verhaltensmustern ausbrechen müssen, wenn wir sie ändern wollen. Veränderung (bzw. Fortbestehen) hat, wie beschrieben, eine räumliche Komponente. Wenn wir hin zu etwas Neuem wollen, dann müssen wir auch in neue Umgebungen eintauchen. Es ist erforderlich die Räume zu ändern, in denen wir lernen, und das grundlegend.
Referenzen
| 1 | Vögele, Sophie / Saner, Philippe (Hg.): Art.School.Differences., Zürich 2022 |
|---|---|
| 2 | DiMaggio, Paul: „Classification in Art.“, in: American Sociological Review, Bd. 52, Nr. 4, 1987, S.440–455. |
| 3 | Lefebvre, Henri: The Production of Space, Oxford 1991 [zuerst Paris 1974], S.143 |
| 4 | Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und Phänomenologischen Philoso- phie. Zweites Buch: Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution (ca. 1913) in: Husserliana Bd. IV, hg. von Marly Biemel, Den Haag 1952, S. 146f. |
| 5 | Ahmed, Sara: Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, New York 2006, S. 59 |
| 6 | Durch das Gebäudemanagement wurden inzwischen professionell gestaltete Piktogramme angebracht. Das Leitsystem weist aber immer noch ausschließlich binäre WCs aus; es bleibt eine ewige Transition. |
| 7 | Stein, Sharon et al.: „Gesturing Towards Decolonial Futures: Reflections on Our Learnings Thus Far.“ Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE), Bd. 4, Nr. 1, S. 43–65. |
Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.
Anstatt zu fragen, wie wir arbeiten sollten, sollten wir fragen, wie wir arbeiten müssen – so Claire Cunningham. Als Claire Cunningham erläutert, was sie damit meint, sitzt die Tänzerin, Performance-Künstlerin und Choreographin im Schneidersitz auf einem Kissen und blickt in die Runde. Ihre graue Krücke hat sie vor sich abgelegt. Was es für Cunningham bedeutet, die Bedürfnisse ihres Publikums von Anfang an konsequent mitzudenken, wird im Verlauf ihres Workshops immer deutlicher. Es ist Donnerstag, der 8. Februar 2024, Tag zwei des Symposiums Unlearning University an der UdK Berlin.
Ankommen
Der Workshop findet in Raum 61Raum 6 ist ein kleiner Raum mit Podest und besonders für Filmsichtungen geeignet. Während des Symposiums war der Raum mit Kissen und Klappmatratzen ausgestattet. im Erdgeschoss des Medienhauses statt. Der Eingang ist ebenerdig und trotz der hohen Altbau-Decke und der großen Fenster wirkt der Raum gemütlich. Dazu tragen die Sitzkissen und Matratzen auf dem Boden und der Tribüne bei, die mit vier breiten Stufen einen Großteil des Raums einnimmt. Zu Beginn ihres Workshops lädt Cunningham alle Teilnehmenden dazu ein, sich in diesem Raum einen Platz zu suchen, den sie als angenehm empfinden. Kissen werden verrückt, einige Teilnehmende machen es sich auf Matratzen auf dem Boden oder der Tribüne bequem und auch ein Rollstuhl findet Platz. Cunningham setzt sich im Schneidersitz auf die Tribüne. Sie weist darauf hin, dass es nicht nur möglich, sondern erwünscht sei, die eigenen körperlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen, sich beispielsweise auch während des Workshops zu bewegen, umzusetzen, hinzulegen oder bei Bedarf den Raum zu verlassen, auch ohne Erklärung.
Die Teilnehmenden werden außerdem dazu eingeladen, sich aus zwei Schachteln mit Stim-Toys zu bedienen. Stim Toys, auch Fidget Toys oder Stimming Tools genannt, sind Gegenstände, die zur körperlichen Stimulation durch repetitive oder ritualisierte Bewegungen, sogenanntes Stimming, genutzt werden können.2Vgl. „Stimming. Self-Stimulating Behaviors.“ in: Psychology Today Online. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/stimming (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). Diese Bewegungen, das Kneten eines Balls etwa, das Langziehen einer Gummischnur oder das Drehen eines Fidget Spinners, können zur Entspannung und zur Fokussierung beitragen. Sie werden insbesondere von neurodivergenten3“Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Normliegend (also als ‚normal‘ oder ‚neurotypisch‘) definiert, … Mehr anzeigen Menschen genutzt, beispielsweise von Menschen mit ASS4Autismus-Spektrum-Störungen oder mit ADHS5Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Doch auch bei neurotypischen Menschen sind die Spielzeuge beliebt.6Stimtoys Online, URL: https://www.stimtoys.ch/pages/uber- uns (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). Cunningham entschuldigt sich dafür, den Workshop nicht auf Deutsch anleiten zu können. Es stehen Headsets für eine digitale Flüsterübersetzung vom Englischen ins Deutsche zur Verfügung. Im Raum befinden sich neun Teilnehmende und eine Person aus dem Awareness-Team des Symposiums. Als Ruhe eingekehrt ist, stellt sich die Workshopleiterin und Künstlerin vor.

Wer ist Claire Cunningham?
Claire Cunningham bezeichnet sich als „self-identifying disabled person“ und als „queer crip“. Ihr ist wichtig zu betonen, dass es sich dabei nicht um eine Fremdzuschreibung handelt. Anfangs beschreibt sie ihr Äußeres, damit auch Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit eine Vorstellung bekommen könnten, mit wem sie es zu tun haben. Claire Cunningham bezeichnet sich als 46-jährige, etwa ein-einhalb Krücken (143cm) große weiße Frau. Die Krücken, so die Künstlerin, seien eine Erweiterung ihres Körpers; sie bezeichnet sich spaßeshalber auch als Vierbeinerin.
Cunningham ist eine international renommierte Performerin und Choreographin. Ihre Performances beruhen häufig auf dem (Fehl-)Gebrauch ihrer Krücken. Traditionelle Tanztechniken, die nicht behinderte Körper ausschließen, lehnt Claire Cunningham bewusst ab.7Vgl. Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT): Prof. Claire Cunningham, Einstein-Professorin. In: HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt … Mehr anzeigen Ihre Arbeiten basieren auf einem „tiefen Interesse an der gelebten Erfahrung von Behinderung und ihren Auswirkungen nicht nur als Choreografin, sondern auch in Bezug auf gesellschaftliche Vorstellungen von Wissen, Wert, Verbindung und gegenseitiger Abhängigkeit.“8Ebd.
Seit Oktober 2023 lehrt und forscht Cunningham als Einstein-Professorin für Choreographie, Tanz und Disability Art am Hochschulübergreifenden Zentrum Tanz Berlin (HZT).9Vgl. Unbekannte*r Autor*in: Claire to become the Einstein Professor for Choreography, Dance and Disability Arts at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT). In: Claire Cunninghams … Mehr anzeigen Das HZT wird in Kooperation mit dem Netzwerk TanzRaumBerlin von der UdK und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch getragen. Claire Cunninghams Fokus liegt in der Forschung auf Crip-Techniken behinderter Tanzkünstler*innen, Praktiken der Fürsorge (care) und Ästhetiken von Zugang (access).10Vgl. Critical Diversity Blog, URL: https://criticaldiversity.udk-berlin.de/abstracts-und-cvs/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024).
Vorstellungen von Care und Access
Zur Vorbereitung, die freiwillig war, hat Cunningham im Voraus zwei Texte zur Verfügung gestellt, auf die sie im Verlauf des Workshops immer wieder eingeht. Der erste ist ihre Abhandlung „Equations of Care & Responsibility“ (Danceolitics, 2021), der zweite das Kapitel 2.6 aus der Critical Diversity Policy der UdK (2024) zum Thema „Accessibility at/of Arts Universities“. Ursprünglich hatte Claire Cunningham geplant, den Workshop zu zweit mit der Künstlerin Angela Alves anzuleiten und die Inhalte im Dialog zu vermitteln. Doch da diese kurzfristig erkrankt ist, hält Claire Cunningham den Kurs nun alleine ab. Sie hätte gerne vermieden, einen Frontalvortrag zu halten, meint sie. Die Künstlerin schlägt daher vor, sich mit ihrem Input auf eine halbe Stunde zu beschränken, bevor die Teilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen nach einer Pause in interaktiven Formaten teilen können. Alle Teilnehmenden stimmen zu und Claire Cunningham erzählt. Es würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, auf all die Punkte einzugehen, die sie anspricht. Deshalb möchte ich hier die zentralen Aussagen festhalten. Wem das nicht reicht, der*dem empfehle ich Cunninghams Aufsatz „Equations of Care & Responsibility“ in dem Sammelband Danceolitics11Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67–78., aus dem Claire Cunningham im Verlauf des Workshops immer wieder zitiert.
Mit dem Begriff care habe sie sich lange schwergetan, erklärt Claire Cunningham. Er provoziere zahlreiche problematische Assoziationen: „Care was a thing done to or for disabled people, rather than something that disabled people had agency or control in.“12Ebd., S. 68 In den vergangenen Jahren habe sie dennoch festgestellt, dass care ein wichtiger Teil ihrer Arbeit geworden sei. Sie habe sich mit anderen Künstler*innen und Kolleg*innen wie Luke Pell, Julia Watts Belser und Jess Curtis ausgetauscht und gemeinsam ein Konzept entwickelt, das sie „the choreography of care“ nannten.
Aus ihrer Perspektive als performative Künstlerin setzt sich Cunningham kritisch mit den Orten auseinander, an denen sie performt. Theater seien historisch betrachtet sehr ableistisch. In der Critical Diversity Policy der UdK wird Ableismus definiert als „die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung, indem Menschen an bestimmten Fähigkeiten gemessen und auf ihre Beeinträchtigung reduziert werden und/oder indem ihnen Zugänge erschwert bzw. verunmöglicht werden.“13Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. Eine Theaterperformance zu besuchen, führt Claire Cunningham aus, bringe je nach Behinderung zahlreiche unterschiedliche Herausforderungen mit sich, von der Anreise über die Frage nach der Zugänglichkeit am Veranstaltungsort, etwa für Rollstühle oder für nicht sehende Menschen, bis hin zu der Frage, ob es eine geeignete Toilette gibt. Hier wird ein Punkt deutlich, den die Künstlerin auch in „Equations of Care & Responsibility“ betont: Information ist Macht (information is power14Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 74.) und je mehr Informationen, desto besser der Zugang (access).
Neben der Angst vor Bevormundung oder ablehnender Behandlung vor Ort gebe es auch Menschen, für die bestimmte Elemente der Performance ein Problem darstellen könnten, zum Beispiel, wenn der Ton ohne Vorwarnung plötzlich laut wird, oder wenn sich die Lichtverhältnisse plötzlich verändern. Auch während der Performance berührt oder angesprochen zu werden, könnte problematisch sein, ebenso, wenn die Performer*innen oder andere Zuschauer*innen erwarten, dass man sich schnell von der Stelle bewegt.15Vgl. Ebd., S. 72 f. Cunningham zählt noch viele weitere Beispiele auf, die den Performance-Besuch für Menschen mit Behinderungen erschweren können.
Häufig gingen Veranstaltungsbesuche für Menschen mit Behinderungen auch mit höheren Kosten einher als für Menschen ohne Behinderung, etwa weil zusätzlich das Ticket und die Anreise für eine Begleitperson bezahlt werden müssen oder weil die zusätzliche Recherche im Voraus und die Planung des Veranstaltungsbesuchs viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Arbeit (work) wolle sie honorieren und respektieren und fühle sich daher ihrem Publikum gegenüber verantwortlich. Hier kommt auch wieder der care-Begriff ins Spiel. Die care-Arbeit, die sie ihrem Publikum gegenüber leiste, gelte insbesondere, aber nicht nur für Menschen mit Behinderungen. Schließlich könne sie nicht davon ausgehen, dass der Besuch einer ihrer Performances für irgendeine Person einfach sei.16Vgl. Ebd., S. 73 f.

Daher orientiert sich Cunningham in ihrer Arbeit an den Kategorien time as care, communication as care, design as care, performance as care und the complexity of care.16 Diese Kategorien ermöglichten, ihre eigene künstlerische Arbeit zu hinterfragen. Ihr Ziel sei es, care für ihre Mitarbeiter*innen, für das Werk selbst und für das Publikum zu leisten – und zwar konsequent und von Anfang an. Darum also geht es ihr, wenn sie sagt, wir sollten uns fragen, wie wir arbeiten müssen, anstatt zu fragen, wie wir arbeiten sollten („We should ask ourselves how we must work instead of asking how we should work“). Dabei spielt Aufmerksamkeit (attention) Claire Cunningham zufolge eine zentrale Rolle. Der Akt des Wahrnehmens (noticing) der eigenen Bedürfnisse und der Bedürfnisse anderer werde zu einem Akt der Fürsorge (care), indem wir basierend auf Aufmerksamkeit und Wahrnehmung Initiative ergreifen und aktiv werden (action).17Vgl. Ebd., S. 70 Für Claire Cunningham bedeutet das unter anderem, dass sie bei der Fortbewegung im Alltag mehr auf den Boden blickt als andere und dass sie in ihren Performances daher häufig versucht, die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Boden zu lenken.
Eine der zentralen Fragen, die sich die Künstlerin immer wieder stellt, ist außerdem, wie sie den Besucher*innen ihrer Performances das Gefühl vermitteln kann, dass es wirklich möglich ist, den Raum zu verlassen, wenn sie wollen. Dies einfach zu sagen, sei oft nicht genug. Sie versuche prinzipiell immer, möglichst alle relevanten Informationen mit dem Publikum zu teilen (information is access). Denn nur so hätten das Publikum wirklich die Wahl (choice), eine Entscheidung zu treffen: information is power. Ihre Verantwortung nehme sie sehr ernst, auch wenn die Entscheidung, Informationen vorab preiszugeben, Einfluss auf das ästhetische Erleben einer Performance haben könne.
Auch in ihrer neuen Position als Professorin am HZT steht Claire Cunningham vor der großen Frage, wie Universitäten inklusiver gestaltet werden kann.
Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität
Auf ihre bisherigen Erfahrungen am HZT wird sie nach ihrem Vortrag auch direkt von einer Teilnehmerin angesprochen. Mit ihrer neuen Position als Professorin gingen neue Herausforderungen einher, erwidert Claire Cunningham. Sie und ihr Team seien dabei zu lernen und herauszufinden, wie das Tanz-Studium für Menschen mit Behinderungen attraktiver werden könne. Den Bewerbungsprozess für Studierende inklusiver zu gestalten sei beispielsweise eine Stellschraube, der sie gerne mehr Aufmerksamkeit widmen würde. Sie stellte aber auch klar, dass dies eine Aufgabe der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter*innen sei, für die ihr die Kapazitäten fehlten. Ihr Fokus liege auf der künstlerischen Lehre. Sie und ihr Team stellten sich deshalb die Frage, wie sie die Verbesserung der Barrierefreiheit am HZT nachhaltig unterstützen könnten. In diesem Zusammenhang spricht Claire Cunningham auch die Critical Diversity Policy der UdK an. In Kapitel 2.6 zu „Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität“18Vgl. Universität der Künste Berlin :Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität (Kapitel2.6), in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der … Mehr anzeigen bekäme sie den Eindruck, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderungen häufig als extrem kompliziert wahrgenommen würde. Oft müsse sie das aber gar nicht sein und kleine Veränderungen könnten schon viel bewirken. In der Policy würden viele wichtige Punkte angesprochen, von der räumlichen über die digitale Barrierefreiheit bis hin zum Nachteilsausgleich für ein barrierefreies Studium.19Vgl. Ebd., S. 44f. Ein Punkt käme ihr aber zu kurz, nämlich die Zugänglichkeit zur Lehre an Kunstuniversitäten. Mit einem höheren Anteil an der Universität angestellter Personen mit Behinderung ginge ihrer Erfahrung nach automatisch mehr Inklusion auch für Studierende einher. Das hinge sowohl mit der Sensibilisierung der Angestellten und Studierenden, als auch mit der Vorbildfunktion der Lehrenden zusammen.
„Tell me something you notice in this room.”
Nach einer Pause machen es sich die Teilnehmenden wieder im Raum bequem, zum Teil an neuen Plätzen. Ein Teilnehmer legt sich auf den Rücken. Wieder lädt die Workshopleiterin dazu ein, die Bedürfnisse des Körpers bewusst wahrzunehmen (attention and noticing): „What you need for your body, feel free to do, if you want to sleep, sleep.“ Einige Teilnehmende lachen, doch Claire Cunningham erklärt, sie freue sich sogar, wenn Besucher*innen während ihrer Performances einschliefen. Das verdeutliche, dass sie sich wohlfühlten. Doch diesmal schläft niemand ein. Stattdessen lassen sich die Teilnehmenden auf die vier Übungen ein, die die Künstlerin anleitet. Die erste Übung hat Claire Cunningham von der Choreographin und Performerin Sara Shelton Mann gelernt. Dafür setzen sich die Teilnehmenden jeweils zu zweit in Paaren zusammen. Jede Person hat eine Minute Zeit, in der sie immer wieder auf die Aufforderung „Tell me something you love“ („Erzähl mir etwas, das du liebst“) antwortet. Nach einer Minute wechseln die Partner*innen und die andere Person antwortet. Diese Übung wird mit drei unterschiedlichen Partner*innen wiederholt. Einige Paare wechseln dafür ins Deutsche. Bei dem Hinweis, bitte nicht zu versuchen, interessant zu wirken, geht ein Grinsen durch die Runde. Ich beobachte gespannt, wie diese persönliche Frage die Stimmung in der Gruppe auflockert, die Teilnehmenden haben sich erst hier und heute kennengelernt. Die zweite Übung funktioniert nach demselben Prinzip, doch diesmal lautet die Aufforderung: „Tell me something you notized today – outside or inside your body“ („Erzähl mir etwas, das du heute festgestellt hast – in deinem Körper oder außerhalb“).
Die dritte und vierte Übung beziehen sich explizit auf das Thema der Barrierefreiheit an Kunstuniversitäten. Wieder wechseln die Gruppen, so dass alle Teilnehmenden einer Person gegenübersitzen, mit der sie noch nicht gesprochen haben. Für die dritte Übung hat jede Person zwei Minuten Zeit. Die Aufgabe lautet: „Tell me something you notice in this room” („Erzähl mir etwas, das du in diesem Raum wahrnimmst“). Hier ginge es um die Frage nach design as care, präzisiert Claire Cunningham, und darum, von welchen Körpern der Raum, in dem der Workshop stattfindet, ausginge.. Alle Gruppen stellen fest, wie stark der Ort das Zusammensein beeinflusst. Zwar gibt es viele gemütliche Sitzmöglichkeiten, doch wäre mehr als ein Rollstuhl im Raum, würde es schon eng werden, das Licht lässt sich nicht ändern und die Fenstergriffe sind so hoch angebracht, dass sie nur von Menschen mit einer bestimmten Körpergröße bedient werden können. Ich muss zugeben, dass mir das als able-bodied Person ohne körperliche Einschränkungen vorher nicht aufgefallen war.
Für die letzte Übung kommt erneut Bewegung in den Raum. In Vierergruppen erzählen die Teilnehmenden aus ihrem Arbeits- und Universitätsalltag und gehen jeweils auf einen konkreten Aspekt ein, der bestimmte (körperliche) Kapazitäten voraussetzt. Wir stellen fest, dass allen Teilnehmenden zahlreiche Beispiele für fehlende Zugänglichkeit (access) im Alltag einfallen. Auch mir fallen einige Situationen ein, die mich persönlich bisher ehrlicherweise nicht gestört haben. Ich halte mich eigentlich für einen reflektierten Menschen, empfinde Barrierefreiheit als wichtig und habe „Equations of Care and Responsibility“20Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67-78. mit Begeisterung gelesen. Deshalb nehme ich auch an dem Workshop teil. Doch in diesem Moment wird mir bewusst, wie viel sensibler ich im Alltag sein könnte und sollte.
Gemeinsam diskutieren wir in Kleingruppen optionale Lösungsmöglichkeiten. Claire Cunningham weist darauf hin, dass es manchmal unmöglich sei, eine Lösung für das jeweilige Problem zu finden. Die Zeit fehlt, mögliche Lösungen für alle angesprochenen Probleme zu diskutieren, doch es gibt viele Ideen. Die diskutierten Fragen werden wir mitnehmen, so das Feedback, wie auch die Ideen für mehr care und access im individuellen Studien- und Berufsalltag. Ich beobachte nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Teilnehmenden eine Sensibilisierung. Viel zu schnell sind zwei Stunden vergangen und der Workshop findet ein Ende. Einige Teilnehmer*innen bleiben, um noch einmal kurz persönlich mit Claire Cunningham ins Gespräch zu kommen.
Und jetzt?
Immer wieder ist im Verlauf des Workshops deutlich geworden, wie ernst Claire Cunningham ihren care-Anspruch nimmt. Das Konzept der „choreography of care“ ist offensichtlich nicht nur eine Theorie, sondern die Grundlage ihres Arbeitens. Ich bin gespannt, wie sich das in Cunninghams neuem Solowerk Songs of the Wayfarer manifestieren wird, das sie im November 2024 uraufführen wird.21Vgl. HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). Dass die Künstlerin in ihrem Einsatz für mehr Inklusion in den Künsten keine Einzelkämpferin ist, zeigen auch andere Projekte wie beispielsweise Making A Difference. Das Langzeitprojekt hat zum Ziel, selbstbestimmte und sichtbare Communities „behinderter, Tauber und chronisch kranker Künstler*innen in der Berliner Tanzszene“ zu fördern.22Making a Difference. Projektwebseite (2024), URL: https://making-a-dilerence-berlin.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 12.03.2024).
An der UdK Berlin wird die im Grundgesetz23Vgl. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. und im Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen24Vgl. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG): Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai … Mehr anzeigen verankerte Forderung nach mehr Inklusion aktuell noch nicht ausreichend umgesetzt, denn es „existieren noch immer Barrieren auf räumlicher, zeitlicher, sprachlicher, organisatorischer und habitueller Ebene.“25Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49.
Wie die UdK der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen entgegenwirken möchte, ist in der Critical Diversity Policy festgehalten. Zentrale Anlaufstellen an der UdK Berlin sind der Beauftrage für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen Christian Schmidts und die Vertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen Inga Kleinecke. Ihre Kontaktdaten und weitere Informationen sind auf der Webseite zur Barrierefreiheit und der Seite zum barrierefreien Studium an der UdK Berlin zu finden.
Referenzen
| 1 | Raum 6 ist ein kleiner Raum mit Podest und besonders für Filmsichtungen geeignet. Während des Symposiums war der Raum mit Kissen und Klappmatratzen ausgestattet. |
|---|---|
| 2 | Vgl. „Stimming. Self-Stimulating Behaviors.“ in: Psychology Today Online. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/basics/stimming (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). |
| 3 | “Wenn die kognitiven Gehirnfunktionen eines Menschen von denjenigen abweichen, welche die Gesellschaft als innerhalb der Normliegend (also als ‚normal‘ oder ‚neurotypisch‘) definiert, dann wird dieser Mensch als neurodivergent bezeichnet.“– Jäggi, Claudia (01.09.2023): 07 Diversität und Eingebundenheit: 7.3 Neurodiversität. In: Schweizerische Gesundheitsstiftung RADIX Online. URL: https://www.radix.ch/de/gesunde- schulen/angebote/schoolmatters/buecher/ein-beitrag-zur-entwicklung-der-schule-mit-psychischer-gesundheit/07-diversitaet-und-eingebundenheit/73-neurodiversitaet/ (zuletzt aufgerufen am 16.03.2024). |
| 4 | Autismus-Spektrum-Störungen |
| 5 | Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung |
| 6 | Stimtoys Online, URL: https://www.stimtoys.ch/pages/uber- uns (zuletzt aufgerufen am 15.03.2024). |
| 7 | Vgl. Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT): Prof. Claire Cunningham, Einstein-Professorin. In: HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |
| 8 | Ebd. |
| 9 | Vgl. Unbekannte*r Autor*in: Claire to become the Einstein Professor for Choreography, Dance and Disability Arts at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT). In: Claire Cunninghams offizielle Webseite, URL: http://www.clairecunningham.co.uk/2023/06/claire-to-become-the-einstein-professor-for-choreography-dance-and- disability-arts-at-the-inter-university-centre-for-dance-berlin-hzt/ (zuletzt aufgerufen am 20.03.2024) |
| 10 | Vgl. Critical Diversity Blog, URL: https://criticaldiversity.udk-berlin.de/abstracts-und-cvs/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |
| 11 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67–78. |
| 12 | Ebd., S. 68 |
| 13 | Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. |
| 14 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 74. |
| 15 | Vgl. Ebd., S. 72 f. |
| 16 | Vgl. Ebd., S. 73 f. |
| 17 | Vgl. Ebd., S. 70 |
| 18 | Vgl. Universität der Künste Berlin :Barrierefreiheit (in) der Kunstuniversität (Kapitel2.6), in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 43 f. |
| 19 | Vgl. Ebd., S. 44f. |
| 20 | Cunningham, Claire: Equations of Care & Responsibility. In: Willeit, Simone und Wolińska, Kasia (Ed.): Danceolitics, Berlin 2021, S. 67-78. |
| 21 | Vgl. HZT Online, URL: https://www.hzt-berlin.de/zentrum/personen/claire-cunningham/ (zuletzt aufgerufen am 10.03.2024). |
| 22 | Making a Difference. Projektwebseite (2024), URL: https://making-a-dilerence-berlin.de/ueber-uns/ (zuletzt aufgerufen am 12.03.2024). |
| 23 | Vgl. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3, Satz 2. |
| 24 | Vgl. Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG): Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert worden ist. |
| 25 | Universität der Künste Berlin: Glossar, in: Critical Diversity Policy. Konzept für Antidiskriminierung & Diversität Universität der Künste Berlin, Berlin 2023, S. 49. |
Dieses Essay ist im Rahmen des Projekts Unlearning University entstanden.

Null: Sexy Logistics
Dieser Text ist ein Verdauungsprozess der Taste-Performance „Institutioneller Beigeschmack“, die am 8.2.2024 beim Symposium Unlearning University stattgefunden hat. Die Unterkapitel dieses Textes tragen die gleichen Titel wie unsere Workshopelemente und geben einen Einblick in einen Abend aus unterschiedlichen Erinnerungen, Bauchgefühlen und Nachgeschmäckern.
Eins: Ankommen
Am Donnerstagabend führt der Weg zum Workshop zunächst über einen roten Teppich hinein in das Medienhaus der Universität der Künste Berlin. Als Erstes schlägt einem die distanzierte Kälte der hohen, weißen Flure entgegen. Ein kleiner Raum, etwas versteckt im zweiten Stock, lädt die Teilnehmenden an einen langen Esstisch ein. Mit Kerzen und Kräutern bestückt, will er ein wärmeres Willkommen aussprechen. Nach und nach treten zögerlich verschiedene Menschen ein und suchen sich einen Platz aus: Studierende, Lehrende der UdK oder anderer Kunsthochschulen, eine Person des Awareness-Teams, Gäst*innen, uns vertraute oder noch unbekannte Gesichter.

Wir beginnen von verschiedenen Richtungen des Tisches aus vorzulesen: Herzlich Willkommen, liebe Beischmecker*innen! Schön, dass ihr da seid und euch entschieden habt, Teil von dieser Tafel zu werden – wohl überlegt oder aus einem spontanen Impuls heraus […]. Tiefer in die Höhlen eurer Münder hinein zu spüren, zu schmecken und mit Zungenspitzengefühl zu ertasten, welche institutionellen Rückstände sich dort abgelagert haben, welche Erfahrungskrümel sich zwischen euren Zähnen eingerichtet haben […]. Bleibende Erinnerungsreste, oftmals unbemerkt, manchmal drückend, die in überraschenden Momenten – in denen ihr euch nicht einmal mehr ihrer Existenz bewusst seid – einen merkwürdigen Geschmack absondern. […] Er füllt die Zwischenräume, sickert in die Schleimhäute auf der Innenseite der Wangen ein und benetzt jede neu eintretende Erfahrung mit seiner eigenen Mischung. Er verändert seine Färbung, lässt sich schwer beschreiben und schwer fassen. Und doch ist er, einmal ausgebreitet, unverkennbar: Der institutionelle Beigeschmack.
An diesem Abend soll es um die schwer verdaulichen Widersprüche gehen, die das Arbeiten in und über Institutionen wie der Kunsthochschule mit sich bringt. In einem multisensorischen Austauschformat lassen wir uns die verschiedenen Formen und Ambivalenzen von Kritik auf der Zunge zergehen – beim gemeinsamen Tischgespräch, begleitet von bittersüßen, knackenden und klebrigen Häppchen, die unsere Erinnerungen anregen.
‚Wir‘ – das sind Destina Atasayar, Lu Herbst, Lucie Jo Knilli, Charlotte Perka und Lioba Wachtel. Als Kollektiv aus (ehemaligen) Studierenden an Kunsthochschulen organisieren wir gemeinsam künstlerische Austauschformate. In unseren Veranstaltungen über strukturelle Ausschlüsse versuchen wir studentischen Zusammenhalt zu stärken und dem ‚Not-Yet‘1Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a … Mehr anzeigen einer zugänglicheren und wertschätzenderen Kunsthochschule näherzukommen. Unsere Zusammenarbeit entstand aus einer Kooperation der Kollektive „Eine Krise bekommen“ (UdK Berlin) und „In the Meantime“ (HFBK Hamburg).
Während sich diese Worte in meinem Mund formen, während ich sie schmecke, während sie mir auf der Zunge zergehen, ist er schon da. Der institutionelle Beigeschmack hat sich selbst eingeladen, wie er es immer tut. Und nun nimmt er Raum ein. Kennt ihr das?
Wir geben die erste Kostprobe herum: Eine Schale mit Beeren, die gleichzeitig salzig, bitter, herb und sauer schmecken.
Welchen Beigeschmack hat dieser Ort für dich? In welchem ‚Wir‘ findest du dich wieder?
Zwei: Balancieren
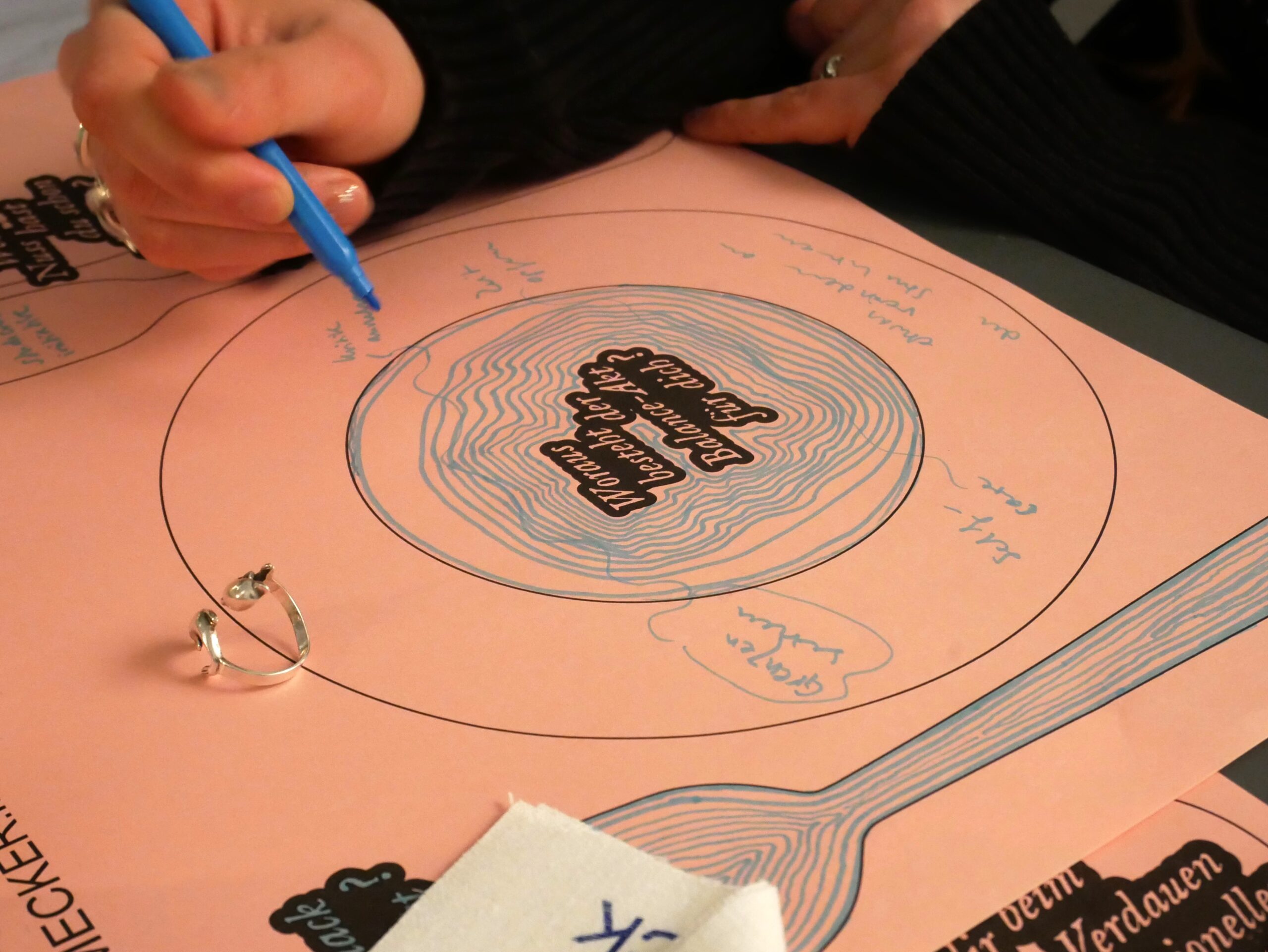
„Trying to address an institutional problem often means, inhabiting the institution all the more. […] Inhabitance can thus involve reentry: you reenter the institution through the back door. You learn about doors, secret doors, trapdoors: how you can be shut out, how you can be shut in.“2Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. – Sara Ahmed
Die Tür zum Workshopraum geht von einem langen Flur ab, der zu den Klassenräumen führt. Unmittelbar daneben befinden sich auch die Büros von Lehrenden und der Verwaltung.
Oftmals sind Flure die Orte, an denen Geschichten geteilt werden, die in vielen Fällen nicht die Türen der innerinstitutionellen Beschwerdestellen erreichen. An diesem Abend geht es um solche Erfahrungen, aber auch um Momente von Widerstand und Resilienz, von Umbruch und Zusammenhalt. Wir teilen Momente der Hoffnung und erzählen von Orten, die uns Kraft gegeben haben auf unseren Wegen durch die verzweigten Flure der Institution.
Egal welche Rolle wir innerhalb der Universität einnehmen, ob als begeisterte Teilnehmende, zurückhaltende Beobachter*innen oder unbequeme Kritiker*innen, wir werden durch sie geprägt. Trotz allergischer Reaktionen nehmen wir die Bewertungskriterien, Referenzen, Hierarchien und Vorlieben in uns auf, die uns auch schon viel früher oder in anderer Form in unserem Leben begegnen. Es sickert in uns ein: Das Wissen und die Wissensarten, welche in diesen Räumen wertgeschätzt, anerkannt oder abgelehnt werden, die Themen, die als relevant betrachtet werden, die Normen und die Vorstellung von Erfolg, von Scheitern und von einer Zukunft, die uns möglich erscheint. Stück für Stück setzt sich aus diesen Erfahrungen, die wir über die Jahre zu uns nehmen, eine eigene kleine Institution in unserer Bauchgegend zusammen. Wir sind an ihrem Bau, oder an ihrer Wiederherstellung, oft nur unbewusst beteiligt und bemerken ihre Existenz häufig dann, wenn eine Situation uns den Unterschied vor Augen hält, der zwischen unseren Wünschen, der Theorie und der Praxis besteht.
Wir sprechen über die Herausforderungen, in unseren selbstorganisierten Formaten nicht die gleichen Barrieren zu reproduzieren, wie wir sie in unserem Studium kennengelernt haben. Es ist uns nicht gelungen, bei unserer letzten größeren Veranstaltung wichtige Momente nicht an den Rand zu drängen: Es blieb zu wenig Zeit für Verdolmetschung, das Besprechen von Konflikten im Team, den Abwasch zwischen den Workshops und eine umfangreichere Sensibilisierung für barrierearme Veranstaltungsorganisation. Die in uns eingenistete Institution und ihr Fokus auf Produktivität und Präsentation gestaltete in vieler Hinsicht mit und wurde von den Förderungsbedingungen verstärkt.
Auch beim Workshop „Institutioneller Beigeschmack“ sind die Wirkungsweisen der Institution spürbar: sie zeigen sich unweigerlich, wenn unterschiedlichen Positionierungen in der Rolle von Lehrenden, Studierenden, Organisator*innen des Symposiums oder externe Besucher*in zusammen am Tisch sitzen. Manche können mit mehr Distanz über ihre Erlebnisse an Institutionen sprechen, da die UdK nicht ihr Studienort oder Arbeitsplatz ist, oder die Anwesenden nicht ihre Kommiliton*innen oder Kolleg*innen. Das schafft An- und Abwesenheiten von bestimmten Geschichten, die sich in diesem Rahmen erzählen oder nicht nicht erzählen lassen, was vor allem in den Kleingruppen spürbar ist. Wie transparent kann der Raum sein und wie viel Verletzlichkeit lässt er zu? Wie sind ein sensibler Austausch und Verbündung zwischen den unterschiedlichen Statusgruppen dennoch möglich, die es für emanzipatorische und respektvolle Lernräume braucht?
„That combination [in a collective] can be a matter of hearing. I listened to each account and I listened again, transcribing, reflecting, thinking, feeling. And in listening to you, becoming a feminist ear […] I also put my ear to the doors of the institution […], listening out for what is usually kept inaudible, who is made inaudible, hearing about conversations that mostly happen between closed doors. I was made able to hear the sound of institutional machinery – that clunk, clunk – from those who came to understand how it works, for whom it works. When I think of the collective assembled here, I think of institutional wisdom. I think of how much we come to know by combining our forces, our energies. I think of how much we come to know because of the difficulties we had getting through.“3ebd., S. 275 – Sarah Ahmed
Drei: Kauen
Unweigerlich lernen wir in unserer Zeit an der Kunsthochschule nicht nur künstlerische Theorie und Praxis. Mindestens genauso groß ist der Anteil an gelerntem Habitus, der sich darin zeigt, wie wir durch die Hochschule navigieren. Wir lernen von unseren institutional heartbreaks, an welchen Türen wir klopfen und in welche (Beschwerde-)Stellen wir das Vertrauen verlieren. Wir lernen, dass viele Hürden, Widersprüche und Erfahrungen uns wieder und wieder begegnen. Die öffentliche Kritik an der gegenwärtigen Lehre kommt nur schwer gegen das Prestige der Hochschulen und ihrer Hauptakteur*innen an.
Wir kauen und malmen auf den Widersprüchen herum und mit jedem neuen Versuch, sie zu zerkleinern und in mundgerechte Stücke zu teilen, scheinen sie noch ein bisschen mehr aufzuquellen. Sie bilden eine zähe Masse. Wir kauen, bleiben kleben und kommen scheinbar nicht vom Fleck.
Erinnert ihr euch, wann sich bei euch zum ersten Mal innerer Widerstand gegen die institutionellen Strukturen geregt hat? Konntet ihr Verbündete finden, etwa durch Blickkontakte und Gespräche? Oder habt ihr euch damit alleine gefühlt? Blieb es bei der einen Situation oder begegnet sie euch immer wieder, immer noch? Konntet ihr Handlungsoptionen für euch entdecken und wo haben sie hingeführt?
Was passiert wohl mit der Kiefermuskulatur, wenn immer wieder und wieder und wieder die gleichen, zähen Widersprüche durchgekaut werden. Gewöhnen wir uns irgendwann an das ständige Kauen, Knirschen und Knacken?
Vier: Nüsse knacken

Fünf: Verdauen
Ähnlich wie der institutional speed4Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. ist unsere Verdauung ein langsamer Prozess. Manchmal löst sich ein unangenehmer Knoten im Magen erst nach Monaten oder Jahren, in denen wir schon längst die institutionellen Räume verlassen haben. Oder wir entwickeln über die Zeit Unverträglichkeiten und müssen einige Zutaten meiden. Genauso verdaut die Universität auch uns, wenn wir aus ihrem Verdauungssystem aus Fluren, Büros, Prüfungsämtern oder Seminarräumen ausgespuckt werden. In diesem Prozess verändern wir uns. Welche Spuren hinterlassen im Gegenzug auch wir in der Institution?
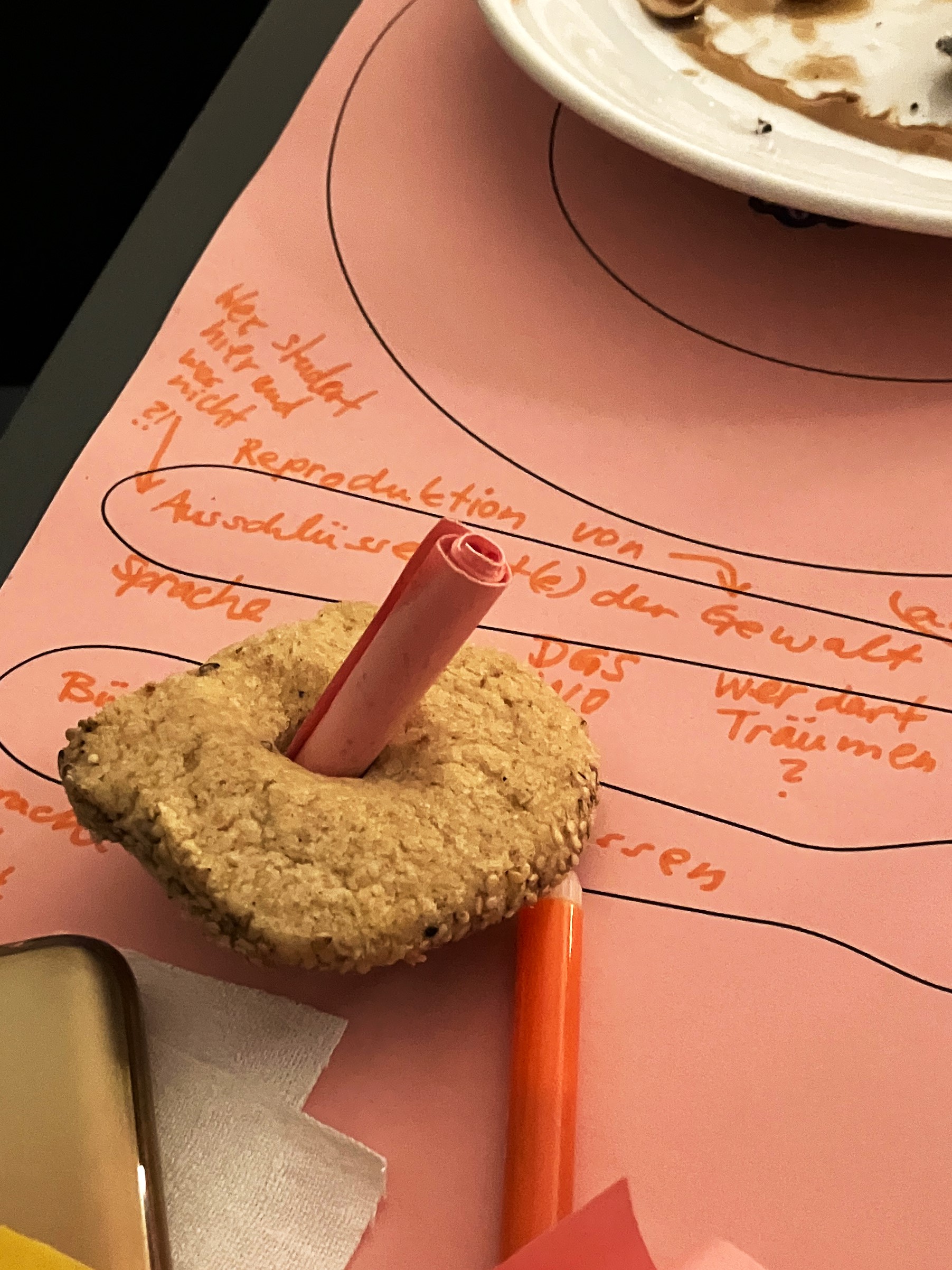
An diesem Abend lernen wir von den anwesenden Personen etwas über Abgrenzungen, Verbundenheiten, Aushalten und Selbstschutz. Von dem Widerspruch zwischen erwünschter Kritik und massiver Gegenreaktion auf Kritik. Von Zukunftswünschen und Tokenism. Von Rezepten für die Verdauung der institutionellen Widersprüche und Unverträglichkeiten.
Zum Abschluss schreiben wir die einen oder anderen institutional wisdoms auf kleine Zettel. Sie werden eingerollt in einen Glückskeks an andere Workshopteilnehmer*innen weitergegeben und finden ihren Weg heraus aus dem Raum mit dem Tisch voller Krümel und Nussschalen, zurück durch die Flure der Universität.
Referenzen
| 1 | Walidah Imarisha und Jeanne van Heeswijk nutzen Visionary Fiction für das Imaginieren einer antidiskriminatorischen Zukunft (‚Not-Yet‘), die sie bereits in der Gegenwart herstellen: „It is a practice in unlearning and committing otherwise to sharing other realities, to other understandings of the past-present or the present-past, and starting to learn from that in order to literally train; not workshopping the not-yet, but actually training to share and commit to other realities in order to build them.“ – Walidah Imarisha in Conversation with Jeanne van Heeswijk and Rachael Rakes: „Living the Not-Yet“, Toward the Not Yet: Art as Public Practice (2021), BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. S. 25–33 |
|---|---|
| 2 | Ahmed, Sara: Complaint, Durham 2021, S. 275f. |
| 3 | ebd., S. 275 |
| 4 | Als institutional speed bezeichnen Tiffany Page, Anna Bull und Emma Chapman („The Group 1752“) die Zeit, die Veränderungsprozesse in Institutionen brauchen. Sara Ahmed: Complaint!, S. 286. |
Im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ fragen Paul B. Preciado und ich uns, ob Dildos, die einige Feministinnen als künstliche Nachbildungen des Penis und damit Symbole der patriarchalen Hegemonie bezeichnen, nicht eigentlich das exakte Gegenteil sind: inhärent queere Objekte, die sexuelle Machtstrukturen verschieben.
Schriftliche Ausarbeitung des Referats vom 20.05.2022 über „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“ in Paul B. Preciado: Kontrasexuelles Manifest. Berlin: b—books 2003. Entstanden im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ im Fachgebiet „Geschichte und Theorie der visuellen Kultur“ an der Fakultät Gestaltung der Universität der Künste Berlin, betreut durch Prof. Dr. Kathrin Peters.

Queer-feministische Ästhetik
Strukturelle Diskriminierung und Benachteiligung beschränkt sich nicht auf öffentliche und private Räume, sondern ist auch im professionellen Umfeld für viele Menschen tägliche Realität. Die Design- und Kunstwelt wurde – wie viele andere Bereiche der Gegenwart – innerhalb der patriarchalen Hegemonie konstruiert. Historisch gewachsene Regeln und Normen der Kunst und Gestaltung, sowie ihrer Rezeption orientieren sich an männlich konnotierten Fähigkeiten und Vorstellungen. Gestaltende mussten sich in vergangenen Jahrhunderten – insofern sie auf wirtschaftlichen Erfolg und Anerkennung hofften – entweder mit vorherrschenden Ideen identifizieren und ihre Regeln anerkennen oder sind der Kunstwelt gänzlich fern geblieben.1 Sich im 21. Jahrhundert in der Branche als nicht-cis-männliche:r Gestalter:in zu behaupten, ist noch immer eine tägliche Aufgabe, die herausfordert und persönliche feministische Positionierungen ins Wanken bringen kann.
Da weibliche Künstlerinnen weder in Museen, noch in Auktionshäusern annähernd so stark repräsentiert sind wie ihre männlichen Kollegen, sah sich das britische Auktionshaus Sotheby’s im Frühsommer 2021 berufen, die Online-Auktion „(Women) Artists“ anzubieten, um weiblicher Kunst der vergangenen 400 Jahre eine dezidierte Platform zu geben und Künstlerinnen der Gegenwart zu fördern.2 Marina Abramović konstatiert eine in der Branche herrschende „sehr große Ungerechtigkeit, da die Arbeiten von weiblichen Künstlerinnen unter ihrem Wert angeboten“3 werden. Dennoch nutzen Kunstschaffende und Gestaltende das Potenzial visueller Kultur – nicht nur als individuelle Ausdrucksform, sondern auch als Instrument im Kampf gegen Diskriminierung und Ausbeutung. Sich dabei von bestehenden normativen Vorstellungen zu lösen, stellt eine besondere Herausforderung dar.
„Im Film und in der Kunst müssen wir auch eine Sprache finden, die uns angemessen ist, die nicht schwarz oder weiß ist.“4 – Chantal Akerman
Das Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ im Fachgebiet „Geschichte und Theorie der visuellen Kultur“ an der Fakultät Gestaltung der Universität der Künste Berlin beschäftigt sich mit der wechselseitigen Beziehung von Gestaltung und gesellschaftspolitischem Kontext. Wann ist Gestaltung feministisch, wann queer? Was macht queer-feministische Ästhetik formal aus und wer ist in der Lage, sie zu produzieren? Wer wird abgebildet und wer nicht? Kann sich Gestaltung, die in einer patriarchal dominierten Welt entsteht, überhaupt von ihr lösen?
„Die Möglichkeit einer anderen Erfahrung und Wahrnehmung der Weiblichkeit durch Frauen wurde als Infragestellung und indirekte Gefährdung männlichen Kunstschaffens häufig schon mit einbezogen.“5
Der binären Norm folgend, bezieht Feminismus traditionell eine oppositionelle Haltung zur patriarchalen Hegemonie, was diese – zum Leid aller feministischen Bewegungen – ständig wiederholt und erhält. Die Literaturwissenschaftlerin Teresa de Lauretis setzt in den späten 1980er und 1990er Jahren in der sog. „Queer Theory“ nicht nur unterschiedliche Diskriminierungsformen miteinander in Bezug und leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zum intersektionalen Feminismus6, sondern beschreibt auch eine Kultur, die sich aus den Eigenschaften und Handlungen ihrer Mitglieder positiv konstituiert und nicht alleinige Gegenhaltung ist.7 Queerness funktioniert nur in der Selbstzuschreibung und definiert sich nicht durch klare Abgrenzungen, weshalb die inhaltliche Bedeutung des Begriffs immer wieder neu verhandelt werden kann und muss. Queer ist keine Opposition, ist nicht anti, sondern fluid und pluralistisch. Doch auch wenn in der nicht-binären Theorie keine gegenüberliegende Seite existiert, auf der ein Gegner verortet werden könnte, existiert er trotzdem auch in der Queer Theory: das Patriarchat.
Angst vor dem Dildo
Symbol des Patriarchats und der Männlichkeit im Allgemeinen ist unumstritten der Penis. Kein anderes menschliches oder nicht-menschliches Organ ist so stark aufgeladen mit Inhalten, wird stolz gezeigt, schamhaft versteckt, auf Schultische gekritzelt, als Foto verschickt, beneidet oder verschmäht. Der Penis ist das prunkvolle Siegelwappen der patriarchalen Vorherrschaft und zeitgleich das sensibelste Glied im organischen maskulinen Kettenhemd. Dass einige Lesben und andere Feministinnen daher Dildos, die in ihren Augen künstliche Nachbildungen des Penis sind, ablehnen, überrascht also kaum. Sie befürchten die (Wieder-)Einführung männlicher Vorherrschaft in ihre durch und durch feminine Sexualität. In den 1990er Jahren boykottierten einige feministische Buchläden in London den Verkauf von Del LaGrace Volcanos „Love Bites“, einer Sammlung von Fotografien, in denen u.a. eine Lesbe zu sehen ist, die einen Dildo leckt.8 Penetration? Ja bitte! Aber mit lesbischen Fingern, die fest mit dem lesbischen Körper verwachsen sind!

Nicht zu leugnen ist, dass Sextoys sich im Allgemeinen einer großen Beliebtheit erfreuen. Laut einer repräsentativen Studie der Technischen Universität Ilmenau, nutzen 52% der heterosexuellen Befragten zwischen 18 und 69 Jahren Sextoys mit Partner:innen. Bei der Masturbation sind es 72% der Frauen und 31% der Männer.9 Nicht repräsentative Studien legen nahe, dass die Zahlen unter queeren Personen nicht etwa geringer, sondern noch höher sind. Genaue Ergebnisse und wissenschaftliche Auseinandersetzungen bleiben jedoch aus. Der Zugang zum Dildo ist auch im wissenschaftlichen Kontext holprig und schambehaftet. Obwohl die Vorstellung von Paul Beatriz Preciados Text „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“, der Teil des „Kontrasexuellen Manifests“ ist, im Lektüreseminar „Queer-feministische Ästhetik“ durch mitgebrachte Objekte, Websites und humoristische Illustrationen niedrigschwellig und zwanglos gestaltet wurde, war die Beteiligung unter den Teilnehmenden eher gering und die Grundstimmung unsicher und angespannt.
Preciado denkt über die Bedeutung des Dildo nach und fragt: „Was ist ein Dildo?“10 Bildet der Dildo patriarchale Machtstrukturen im queeren Kontext ab? Ist er Projektion des maskulinen Begehrens auf die weibliche Sexualität? Welche Rolle spielt dabei seine Ästhetik und die Perspektive, aus der er betrachtet wird?

Preciado beschreibt im Text „Die Logik des Dildos oder die Scheren Derridas“ eine Szene aus Sheila MacLaughlins Film „She Must Be Seeing Things“ (1987), in der sich die Protagonistin Agatha in einen Sex-Shop begibt, um einen realistischen Dildo zu kaufen. Sie glaubt ihrer Geliebten damit zu gefallen. Beim Anblick des Dildo erkennt sie das zwischen Männern und Frauen herrschende Ungleichgewicht im Zugang zu Sexualität: aufblasbare Puppen – Nachbildungen des gesamten weiblichen Körpers – stehen Dildos – in ihren Augen plumpe Penis- Mimesen – gegenüber. Während männliche Sexualität durch den weiblichen Körper in seiner Ganzheit angesprochen wird, soll die weibliche Sexualität durch den Penis bzw. seine Nachbildung angeregt werden. Agatha entscheidet sich schließlich gegen den Kauf eines Dildos, dessen bloßer Anblick ihr zur Einsicht dieses Machtgefälles verholfen hat. Vielleicht befürchtet sie, dass das sexuelle Begehren ihrer Partnerin sich mit Verwendung des Dildos nur noch auf diesen beschränke und Agathas Körper fortan ausschließe. Preciado stellt fest, dass sich Agathas Sichtweise in diesem Moment der Konfrontation lesbischer Sexualität mit Heterosexualität durch den Dildo verändert und verweist auf Lauretis, die im Dildo einen kritischen, jedoch keinen praktischen Wert erkenne.11
Sowohl Agathas Erkenntnis, als auch Lauretis’ Analyse bauen auf der Annahme auf, dass „jeder Hetero-Sex […] phallisch und jeder phallische Sex […] hetero“12 sei: wenn zwischen Mann und Frau die Penetration durch den Penis ausbleibt, könne – egal wie intensiv die physische Auseinandersetzung ansonsten sein mag – nicht von Sex gesprochen werden. Sobald zwischen Personen ohne Penis penetrative sexuelle Handlungen stattfinden, sei die Referenz zum imaginierten Penis und damit dem Mann und damit dem Patriarchat hergestellt. Im angenommenen phallozentrischen Schema steht der Penis im Mittelpunkt jeglicher Sexualität und sexueller Handlungen. Neben zwischenmenschlichen Interaktionen, wird auch der singuläre weibliche Körper durch die Abwesenheit des Penis definiert. Die Misogynie dieses Denkmodells liegt auf der Hand. Lauretis bringt den Sachverhalt passend auf den Punkt: „Weibliche Sexualität wurde stets im Gegensatz und in Bezug auf männliche Sexualität definiert.“13
Durch die Kombination von Phallozentrik und Verwechslung des Penis mit der ihm zugeschriebenen patriarchalen Macht, ergeben sich sowohl für den Penis, als auch für den Dildo und letztlich die Sexualität selbst fatale Urteile. Diese Kette von Fehlannahmen zurückzuverfolgen, neu aufzuziehen und den eigentlichen Wert des Dildo zu erkennen, erscheint Preciado angebracht.
„Der Phallus ist nur eine Hypostasierung des Penis. Wie bei der Geschlechtsfeststellung intersexueller Babies deutlich wird, ist in der symbolischen heterosexuellen Ordnung der Signifikant par excellence nicht der Phallus sondern der Penis.“14
Schließlich enttarnt der Dildo den Penis und befreit ihn damit vom Gewicht des Phallus. Er offenbart, dass die assoziierte Macht eben kein angewachsenes Recht ist, sondern an jedem beliebigen Körper(-teil) umgeschnallt oder angesaugt werden kann. Sie ist ein Zepter, das beliebig von Hand zu Hand weitergereicht wird. „Der Dildo erscheint als exakte Nachahmung des Penis, bleibt aber vom männlichen Körper abgetrennt.“15 Es klingt wie das Horrorszenario eines jeden Mannes: das Glied ist abgetrennt und wird mal hier, mal dort benutzt, abgelegt oder im kochenden Wasser sterilisiert. Trotzdem ist es voll funktionsfähig – oder sogar noch praktikabler als der organische Referent. Kontrolle und Macht sind nicht angeboren, sondern werden egalitär weitergereicht und nach Lust und Laune eingesetzt. Preciado betont, dass jede:r einen Dildo benutzen und so genderbezogene phallische Machtstrukturen verschieben und in Frage stellen kann.
Vielleicht ist die Angst vor dem Dildo genau deshalb so groß. Die Anerkennung des Dildo als effektiver sexueller Technologie würde dem oder der Besitzer:in eines Penis vor Augen führen, dass ihr bestes Stück eben nur eines ist: ein sensibles Organ. Aber soll diese Erkenntnis nun als Degradierung verstanden werden oder könnte die Anerkennung seiner einzigartigen organischen Fähigkeiten und die gleichzeitige Akzeptanz der technischen Möglichkeiten des Dildo nicht eine Chance sein, die sowohl der Lesbe, als auch dem Hetero-Mann, als auch jeder anderen Person und ihrer Sexualität zugute käme?

Kontra-Sexualität
„The first twelve years or so I was very busy with trying to turn men on. […] and then after that it was like turn on other kinds of people, but not just in the genitals, but more the mind, the intellect, […] make them laugh, make them think, help them to learn something new“ – Annie Sprinkle16
Wahre Gleichberechtigung kann in jedem noch so kleinen Winkel des gesellschaftlichen Alltags nur bestehen, wenn sie auch dort Realität ist, wo Körper im vermeintlich Privaten und Intimen aufeinandertreffen: beim Sex. Tabus, Scham und Unsicherheit bieten den Nährboden für Gewalt und Missbrauch. Preciados Beitrag zu Gleichberechtigung, für die eine gesunde Sexualität unerlässlich erscheint, ist das Konzept der „Kontra-Sexualität“. Sie handelt „vom Ende der Natur, die als Ordnung verstanden wird und die Unterwerfung von Körpern durch andere Körper rechtfertigt“17. Preciado sieht Individuen nicht mehr als Mann oder Frau, sondern als Subjekte, die zu allen signifizierenden Praktiken gleichermaßen Zugang haben und untereinander gleichwertig sind.
Der Dildo sei das Werzeug der „systematischen Dekonstruktion sowohl der Naturalisierung der sexuellen Praktiken als auch der Geschlechterordnung“18. Dabei geht Preciado so weit, den Dildo als „Ursprung des Penis“19 zu bezeichnen. Diese Umkehrung der eingangs beschriebenen Annahme, der Dildo sei eine Nachahmung des Penis, begründet Preciado mit dem was Derrida als „gefährliches Supplement“ bezeichnet. Das Supplement, vereinfacht übersetzt als „Ergänzung“ oder „Zugabe“, fügt sich etwas hinzu oder setzt sich an die Stelle von etwas, zeigt aber auch die Lücke an, die es füllt. Der Dildo als Supplement vervollständige und produziere den Sex und damit auch den Penis.20
Derrida schreibt: „das Supplement, ob es hinzugefügt oder substituiert wird, [ist] äußerlich, d.h. äußerliche Ergänzung oder Ersatz […]; es liegt außerhalb der Positivität, der es sich noch hinzufügt, und ist fremd gegenüber dem, was anders sein muß als es selbst, um von ihm ersetzt zu werden.“21 Der Dildo bleibt außerhalb des organischen Körpers und ihm damit immer fremd. Er ist eine menschgemachte Maschine, die dem Penis nicht fremder sein könnte, obwohl er sich auf paradoxe Weise an ihm orientiert. Da er nie nur Substitut ist und im Substitut-Sein nicht aufgeht, sondern mehr ist, übersteigert er sich fortlaufend selbst. Er zieht die Autorität seines Referenten ins Lächerliche und widersetzt sich damit heteronormativem Sex.22
Preciado stellt fest: „Der Dildo ist kein Objekt, das sich an die Stelle eines Mangels setzt.“23 Bislang galten die Genitalien als Zentrum der Sexualität. Der Dildo verschiebt dieses Zentrum hin zu anderen Stellen des Körpers und hin zu Objekten außerhalb des Körpers, die durch den Dildo (re-)sexualisiert werden. Die Dezentrierung, die der Dildo auslöst birgt die Chance, den gesamten Raum, über den Körper hinaus, in mögliche Zentren umzuwandeln, bis der Begriff des Zentrums seinen Sinn verlöre.24
„Die Verdrängung der Penetration aus dem Mittelpunkt des sexuellen Geschehens bleibt eine Aufgabe, der wir uns auch heute noch zu stellen haben“25
Der Dildo destabilisert die sexuelle Identität der Person, die ihn trägt und restrukturiert damit auch das Verhältnis zwischen innen und außen, passiv und aktiv, zwischen dem natürlichen Organ und der Maschine.26 Der Dildo ist nicht-binär. Er konstituiert Sexualität positiv und ist somit im doppelten Sinne und inhärent queer.

Laura Thiele (Sie/ihr) studiert visuelle kommunikation an der universität der Künste Berlin und bewegt sich in ihrer gestalterischen Arbeit im Spannungsfeld zwischen Raum, Körper und Gesellschaft. Sie ist stellv. Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Fakultät Gestaltung.
1 Vgl. Silvia Bovenschen: Über die Frage: gibt es eine „weibliche“ Ästhetik?, in: Ästhetik und Kommunikation, Beiträge zur politischen Erziehung, Heft 25, Jahrgang 7, Berlin, 1976, S. 61
2 Vgl. Sotheby’s: (Women) Artists, 2021, https://sothebys.com/en/buy/auction/2021/women-artists (abgerufen am 09.09.2022)
3 Amah-Rose Abrams: Marina Abramović: A Woman’s World, 2021, https://sothebys.com/en/articles/marina-abramovic-a-womans-world (abgerufen am 09.09.2022)
4 Chantal Akerman. Interview mit Claudia Aleman in: Frauen und Film, Nr. 7, Berlin, 1976, zitiert nach Silvia Bovenschen: Über die Frage: gibt es eine „weibliche“ Ästhetik?, in: Ästhetik und Kommunikation, Beiträge zur politischen Erziehung, Heft 25, Jahrgang 7, Berlin, 1976, S.63.
5 Bovenschen: 1976, S. 68.
6 Dieser Begriff gehört heutzutage zur Grundausstattung eines jeden queeren Tinder-Profils.
7 Vgl. Teresa de Lauretis: Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities, An Introduction, in: Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Heft 3.2, Providence, 1991, S. 11.
8 Vgl. Paul B. Preciado: Kontrasexuelles Manifest, Berlin, b_books, 2003, S. 54.
9 Vgl. Nicola Döring & Sandra Poeschl: Experiences with Diverse Sex Toys Among German Heterosexual Adults: Findings From a National Online Survey, The Journal of Sex Research, 2020
10 Preciado: 2003, S. 53.
11 Vgl. Preciado, 2003, S. 57.
12 Preciado, 2003, S. 58.
13 Teresa de Lauretis: Die Technologie des Geschlechts, in: Elvira Scheich (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie Hamburg (Hamburger Edition) 1996, S. 468.
14 Preciado, 2003, S. 59.
15 Ebd. S. 61.
16 Virginie Despentes: Mutantes – Annie Sprinkle Interview, 2018, https://youtu.be/Bdl5xscdC_0 (abgerufen am 01.09.2022), 05:02-05:26
17 Preciado, 2003, S. 10.
18 Ebd. S. 11.
19 Ebd. S. 12.
20 Vgl. ebd. S. 62.
21 Jacques Derrida: Grammatologie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, S. 251
22 Vgl. Preciado, 2003, S. 62.
23 Ebd. S. 61.
24 Vgl. ebd. S. 65.
25 Lucy Bland: The Domain of the Sexual. A Response. in: Screen Education, Heft 39, S.56, 1981, zitiert nach Teresa de Lauretis: Die Technologie des Geschlechts, in: Elvira Scheich (Hg.): Vermittelte Weiblichkeit. Feministische Wissenschafts- und Gesellschaftstheorie
Hamburg (Hamburger Edition) 1996, S. 469.
26 Vgl. Preciado, 2003, S. 67.
Karla Yumari hat sich im Rahmen des Seminars Feministische und dekoloniale Gesten und Ästhetik von Pary El-Qalqili im Wintersemester 2021/2022 an der UdK Berlin mit verschiedenen Themen rund um intersektionalen Feminismus beschäftigt. Dabei ist dieser Brief entstanden, den wir hier auf Mexikanisch1 veröffentlichen. In Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Zugehörigkeit stellt Karla die Geschichte ihrer verstorbenen mexikanischen Urgroßmutter ihrer eigenen Vergangenheit und Gegenwart gegenüber.
Als Grundlage dienten Texte von Alice Walker, bell hooks, Gloria Anzaldúa, Saidiya Hartman sowie Trinh Minh Hà.
Querida Abuelita,
esta carta me va llevar a lugares de cuales no sabía
lugares que siempre has cuidado
en mi alma,
en mi corazón
historias las cuales tú viviste
me las compartes
y yo, yo las vivo
contigo en mi presente
Quisiera que esto fuera una plática entre tu y yo. Aurora, la mujer a la que nunca conocí pero igual siempre has estado allí. En cada cuento que mi Padre me contaba, en cada una de las historias de las cuales Opa Luciano me hablaba, siempre estabas allí. Hablando con cariño los pensamientos de mi Opa Luciano se iban a recuerdos, a lugares lejanos. Igual estabas cerca cuando contaban historias, cuando pensaban en el pasado.
Estaríamos en la casa tuya Aurora, allí en Oaxaca en el patio con la luz más suave, los árboles con frutos de Lima y la mesita de plástico. Recuerdo esa mañana en mi niñez, contigo allí, la cual nunca conocí. Pero siempre estabas allí. En Silacayoapan, la tierra que compartimos. Naciste y creciste allí . Aurora, la mujer que veo en las fotos, tiene una fuerza que resalta de la imagen. Veo el cariño en tus ojos y el altruismo en tus manos.
Igual veo tu rostro y me veo, me reconozco. El momento en el cual naciste fue casi 100 años antes de que yo naciera. Eras una de muchos hijos en tu familia; en tiempos de revolución y peste. Mucha de tu realidad era muy lejana de la mía.
Me cuentan que desde chiquita cuidabas a niños, los cuales la revolución y la peste les quitó sus padres. Con cariño los criabas uno por uno. Abuelita, ¿sabes de cuántas historias eres parte? Una mujer que formó a tantas vidas, que tantas de esas vidas te siguen llevando en sus historias. Y yo soy una de esos niños, una de esas historias en las que sigues viviendo . Te cuento que pienso que en tu forma de pensar la familia, veo una forma de pensar la familia en un sentido feminista. Con tu hermana, Catalina criaste niños que a pesar de que nos les diste luz, crearon una comunidad. Un hogar, una forma de familia. Pensando en el significado de la familia,
la que me enseñaron que debo desear,
de la mía, que entre amor y muchas lágrimas, se construyó
e igual la que yo estoy aprendiendo de poder soñar
Pienso cómo quiero ver a la familia, cuáles comunidades quiero crear y puede ser que tenemos más en común que hacen parecer esos 100 años que nos separan. Con tu hermana criaron a muchos niños, vivieron juntas y hasta el final se cuidaron entre ustedes. Yo con mi hermana, mis amigas, mi pareja en conjunto así quiero criar a los niños de cada una. Como tu abuelita ¿Me podrías contar qué tan fácil puede ser amar a cada niño, sin que importe quién le dio luz? ¿Igual me podrías contar qué tanto quisiste dar luz a un hijo y cuánto tiempo pasó para que se volviera realidad tu deseo? “La bendición” le dicen a los hijos y para ti mi Opa Luciano seguro fue eso. Sé que creíste mucho en Dios. Viviste tu vida siguiendo las reglas de la Iglesia y tengo todo respeto a eso. Pero viendo la crueldad que viene hasta hoy con la religión católica, me cuesta entender el amor que mi familia mexicana le tiene a la fe. Más cuando todo en el presente recuerda al dolor del pasado. En un pueblo que fue maltratado por los conquistadores igual se comunicaban con el lenguaje de los conquistadores. Cuando llegué de méxico a alemania me enojaba porque nadie sabía ni que méxico no era españa, ni que mexicano no era el lenguaje que yo hablaba. Pero un querido amigo mexicano me dijo que él igual no hablaba español, que él hablaba la lengua de Mexico, el mexicano y abuelita creo que ahora yo igual hablo mexicano. Sea la religión o la lengua, la apropiamos y la hicimos nuestra pero hasta hoy siento el dolor que lleva cada palabra. Busco mi identidad en un lengua que duele y solo puedo apreciar de lejano la lengua que tú hubieras hablado, la que yo hablaría. Y siempre pienso en eso, con amor uso mis palabras en mexicano, las busco y
me cuestan pero las amo. Igual las amo porque son las tuyas, son tus palabras que me prestas. Las mismas, las que tú usabas e igual traían el dolor de un lenguaje que ninguna de nosotras dos pudo hablar. El lenguaje es lucha e igual por eso amo el mexicano, nuestro lenguaje, el lenguaje de amor y familia, de historias compartidas. Más y más he conectado con las palabras; no solo hablando sino escribiendo y pensando.
Busco y busco las palabras, la lengua, lo que quiero decir, las historias que quiero contar. Igual esa búsqueda es una lucha.
cada dia defino
cada dia extiendo
cada dia reinvento
cada dia defiendo
mi búsqueda, mis palabras, mi lenguaje, mis historias y mis espacios
Pero con amor coloco cada palabra.
Me muevo en las calles, dejo mis pensamientos flotar, siento mi alma que se alimenta de esos momentos. Los pequeños momentos en donde ando solo yo, yo en un espacio que creo para dejar flotar los pensamientos ¿Abuelita tú tuviste esos momentos de poder estar sola? En calma contigo, un momento pequeño. Un momento en el patio de tu casa entre los árboles de Lima, un momento en donde los niños dormían, los mosquitos se quedaban quietos, el aire suave tocaba tu piel y el olor a tierra húmeda alimentaba el aire ¿Qué hacías en esos momentos? ¿Igual te gustaba escribir o dibujar? ¿A dónde se iban tus pensamientos? ¿De cuáles cuentos soñabas? Por los años del 1993 escribiste una carta a mi Opa Luciano, que decía “Ya llegaron los tiempos”, siento que en esas únicas palabras de las que se que fueron escritas por ti hay tanta poesía y tanto amor. Los tiempos llegan, algo nuevo comienza, la forma con la que le quisiste avisar a tu único hijo que ya pronto morirías. Me gustaría pensar que igual tu buscabas tus palabras y las colocabas con amor. En tus pensamientos colocabas y buscabas esas palabras. Nadie nunca las vio ni las escuchó, pero allí estaban y allí continúan. Yo las llevo en cada letra que escribo, en cada palabra que digo. Las escribo en mi mi libro negro, 13cmx10cm. Cada dia lo lleno con mis palabras, con tu palabras, con las nuestras.
Escribo de lo que me alegra, escribo de lo que me hace llorar, escribo de lo que amo y de lo que odio, de mis miedos y mis sueños. Escribo del amor y de la belleza, de una mujer, la cual me hace feliz. Y abuelita ese amor es el mismo que tú llevas en tu corazón.
Compartimos el mismo amor sin saber si estaríamos en la misma lucha. Pero contigo coloco las palabras en mi libreta. 13cmx10cm que no tuviste. No te esperaban hojas para llenar cuando te daba tiempo de descansar. Tu soñabas de los colores más fuertes, que ahora, yo busco y dibujo. Me paso horas y horas buscando espacios en los cuales puedo pasar mi tiempo buscando mis colores y ordenando mis palabras, poniendo en orden nuestro mundo.
Esos 13cmx10cm siempre llevan mi nombre y con eso empiezo ponerle orden a nuestro mundo. Karla Yumari Martinez Royal. ¿Cuál sería tu libreta? Igual quieres esas hojas de 50mg, que se manchan con cada color que escoges usar?
pondrías tu nombre en la primera página:
Aurora Avila de Martinez
o pondrías Ramirez? Igual cada vez sería el nombre de tu marido muerto, el nombre que indica pertenencia. Me duele leer tu nombre así “DE” Martinez. Me cuenta que eres propiedad de alguien, de un hombre. Pero nunca pertenecemos a nadie. No somos propiedad. Porque eso no va a la utopía de la que yo sueño, la utopía que llevas en tus historias. Poseer es patriarcal, sea la tierra o las mujeres. El sistema patriarcal nos ve como propiedad y abuela estoy segura que tu alma era de las más libres,
nunca nadie la pudo pertenecer
como yo no soy de nadie
y tú eres la tuya.
Nuestras piernas las tuyas y las mías nos dejan partir los ideales de propiedad y de querer poseer a otro ser. Pero tu lo traías hasta en tu nombre y a mi me cuesta decirle a mi novia –que no le quiero decir que es “mía”–, porque es libre y nadie la puede poseer.
Nadie nos puede poseer ni nos puede encerrar, somos libres hasta las fronteras de nuestros privilegios. Igual tu hermana pequeña llegó a las fronteras de sus privilegios y sus privilegios la dejaron encerrada. Se la llevaron, se la robaron. Una más que pienso y pido por ni una más que se llevan, ni una más que se toman
como una mercancía.
Y cuando hablo de la posesión y de los hombres que se las llevan, y de los nombres que se las prometen, abuelita hablo de un mundo que no encuentro las palabras para poner orden. Busco y busco, las páginas se llenan y la voz igual es mía cuando todas piden que no somos de nadie y ni una más!
Abuelita, te veo en las fotografías y en las historias y sé que mujer tan fuerte y luchadora eres. Abuelita, por tu ser, yo soy la que soy.
Karla Yumari Martinez Royal. Igual, no la soy. Mi pasaporte alemán dice mitad de mi nombre. Karla Yumari Royal. Nunca dice Martinez, traigo el nombre de mi mamá y te digo que no pertenecemos a nadie pero, igual quiero pertenecer. Quiero ser parte.
Cuando Chavela Vargas cantaba en el coche de Opa Luciano que “no soy de aqui ni soy de allá” yo solo podía anhelar con mi mirada los paisajes que pasaban. Que ni yo era de allí. Pero sentía con todo mi corazón la pertenencia a esas tierras. Los paisajes que pasaban y me contaban de las historias, las cuales traían tu nombre.
Los viajes al pueblo. Abuelito, Opa Luciano siempre manejaba y durante todo el viaje acariciaba con su mirada el paisaje. Escuchábamos Chavela Vargas, Lola Beltran y Pedro Infante. Pasamos las sierras secas con los nopales infinitos, las montañas que cuidaban la selva y los acantilados que me hacían cerrar los ojos. Pero yo no era de allí, y si lo soy. Buscando mi casa recorrí muchas sierras, montañas y acantilados.
Pero por un tiempo no estaba en casa en ningún lugar.
Con cariño recuerdo cada viaje a Oaxaca, a nuestras tierras que nunca son nuestras. Las tierras en las cuales sembrabas. Tu huerto, Abuelita. Me contaron que sembrabas frijoles, maíz y cerca del río, caña. Y cuando llegué allí, igual recuerdo como los bueyes cultivaban la tierra para sembrar. La tierra era oscura y fértil. Recuerdo el olor cuando en la mañana apenas salía el sol y la tierra respiraba por primera vez. Recuerdo esa mañana en mi niñez: contigo allí, la cual nunca conocí. Comí mis tortillas azules con una taza de chocolate oaxaqueño. Me lo sirves con una cuchara en mi taza de barro, la cual sabe a la tierra de tu huerto . Y allí, allí en tu patio, entre los árboles de Lima. En la mesita de plástico, sabía que igual allí estoy en casa.
Porque allí a mi espalda llevo mi casa, la llevo contigo por dentro a donde yo vaya.
1 Im Text wird auf die Selbstbezeichnung der eigenen Sprache als Akt des Empowerments näher eingegangen.
Karla Yumari studiert Architektur an der UDK Berlin und setzt sich mit queer-feministischen Themen innerhalb der Architektur sowie in ihren kreativen Arbeiten auseinander. Sie nähert sich diesen Themen durch Fotografie und kreatives Schreiben an.
Gender is performance. But how does it perform? On the occasion of the Medienhaus Lectures 2021 at Berlin University of the Arts, Paris based writer and researcher Claire Finch re-visited the queer-feminist notion of gender’s performativity. We publish the lecture together with an introduction by Annika Haas, who co-organised the two-day conference together with Henrike Uthe.
Claire Finch is a writer and researcher whose work samples queer and feminist theories as a way to intervene in narrative. Their recent projects include „I Lie on the Floor“ (After 8 Books, 2021), „Lettres aux jeunes poétesses“ (L’Arche 2021), „Kathy Acker 1971-1975“ (Editions Ismael, 2019) and their translation into French of Lisa Robertson’s „Debbie: An Epic“ (with sabrina soyer, Debbie: une épopée, Joca Seria, 2021).
Regarding the notion of performing gender, Claire Finch intervened into a common misunderstanding of the concept coined by Judith Butler right in the beginning of their lecture stating that “it’s not about acting, but more about interrupting the idea of what it means to be an actor, to be a self, to have a body […]”. In turn, even what has been called the “assigned sex” presented itself as “the residue, the result of citing re-citing gender gender gender as the body gets all solid in repetition”. Tackling this issue, Finch’s contribution to the conference motto “Performance? Performance. Performance!” was an exercise in stretching, bending, loosening and cross-cutting the identities that form and solidify in bodies and “the residue of sex and language” respectively. This exercise is physical, emotional, sensational and text-based, all at once. Finch proposes to utilize strategies like plagiarism, body functions like vomiting, technologies like sex toys, and last but not least language for what they broadly understand as “textual intervention” into the livid residue of our bodies and in order to cross-cut their identities.
In this way, seemingly separate spheres and practices in themselves – e. g. writing and using sex toys – creatively begin to inform each other. Considering for example, as Finch remarked, that “[y]ou can attach a sextoy to any part of the body and transform that part of the body into a sexual surface” not only decenters sex and the gendered body. It also inspires textual strategies: “What happens when we think of the sextoy as a textual graft, if we perform the same decentering and reorganizing operations on form, as we do on the body?”
Making these connections by translating and transposing concepts and practices from one medium and form into another and thus allowing for mutual interventions – e. g. of the body or the sex toy into the text and vice versa – is what drives their practice, as Finch underlined in the discussion that followed the lecture and that left the audience with an inspiring task: To develop further dissident strategies with their bodies and tools of their choice in order to practically do these things that we say we want to do in theory.
Annika Haas is a media theorist and works as a research associate at the Institute for History and Theory of Design of Berlin University of the Arts (UdK). She completed her PhD on Hélène Cixous’s philosophy and embodied writing practice. Annika’s practice at the intersection of art and theory includes art criticism and experimental publishing.
Zu den Medienhaus Lectures werden einmal im Jahr Gestalter*innen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten an die Universität der Künste Berlin eingeladen. 2021 fanden die Medienhaus Lectures als Kooperation zwischen Gestaltung und Theorie statt und wurden von Henrike Uthe und Annika Haas organisiert. Unter dem Motto „Performance? Performance. Performance!“ stellten sie den menschlichen Körper als Akteur sowie Adressat von Design in den Mittelpunkt und fragten: „Wie divers sind die Körper, die an Entwurfsprozessen beteiligt sind? Wie differenziert ist das Körperbild im Design? Welche Normen und Regeln werden daraus abgeleitet? Und wie wirken diese auf unsere Körper zurück?“ Wir veröffentlichen hier die Aufzeichnung der Lecture der Gestalterin Hannah Witte zu gendersensibler Typografie sowie eine Tagungsnotiz von Annika Haas.
Hannah Witte (sie*ihr) ist Grafikdesignerin und lebt in Leipzig. Ihre gestalterische Praxis dreht sich hauptsächlich um feministische Themen, Gender-Stereotype und non-binäre Typografie und wurde 2021 mit dem iphiGenia Gender Design Award ausgezeichnet. Ihr Buch Typohacks – Handbuch für gendersensible Sprache und Typografie erschien 2021 im form Verlag.
Sprache befindet sich in einem permanenten Wandel. Das zeigt sich nicht nur in gendersensiblen Sprech- und Schreibweisen, sondern auch im Schriftbild. Mit Typohacks (form-Verlag 2021) hat Hannah Witte den ersten Leitfaden zur Gestaltung gendersensibler Typografie im deutschsprachigen Raum vorgelegt. Auf den oft kaum beachteten Zusammenhang von Sprache und Typografie machte sie bei den Medienhaus Lectures mit der Wortschöpfung „Ortho-Typografie” aufmerksam. Kathrin Peters hob als Moderatorin des Talks zudem hervor, dass Typografie und Sprache voller Normen seien und der Genderstern diese Normiertheit kenntlich mache. Denn da es sich dabei um ein Sonderzeichen handelt, das in den meisten Fonts anders als Buchstaben skaliert ist, sticht es im Schriftbild hervor bzw. fällt heraus. Während es zunehmend Fonts gibt, die den Genderstern gleichrangig mit Buchstaben setzen1, regt Typohacks dazu an, den Genderstern variabel und kontextuell einzusetzen: Mal bedarf es vielleicht eines Unruhe stiftenden „Gender-Trouble-Sterns“, mal ist eine barrierearme Einbettung wichtiger. Etwa, wenn es um Texte geht, die für Menschen mit Legasthenie gut lesbar sein sollen. Dabei spielen, wie die Designhistorikerin Anne Massey zeigt, ganz andere Kriterien als die normativ formulierten für ‚gute Lesbarkeit‘ eine Rolle.2
Dass sich die Frage nach ‚guter Lesbarkeit‘ nur spezifisch beantworten lässt, zeigte bei den Medienhaus Lectures 2021 auch das Werkstattgespräch zwischen dem Designstudio Liebermann Kiepe Reddemann und den Direktor*innen der Kunsthalle Osnabrück Anna Jehle und Juliane Schickedanz über die gemeinsame Arbeit an der Website für das Jahresthema „Barrierefreiheit“. Fazit: Was barrierearm ist, ist eine Frage des*der jeweiligen Betrachter*in bzw. Zuhörer*in. So unterbricht der Genderstern den Textfluss auch auf akustische Weise, wenn Screenreader Texte vorlesen. Sie interpretieren z. B. „Gestalter*in“ als: „Gestalter, Stern, in“. Unabhängig von der Typografie verhalten sich Buchstaben und das nichtlautliche Zeichen * damit auf der akustischen Ebene weiterhin disparat zueinander. Sofern keine genderneutralen Alternativen gefunden werden können, empfiehlt der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband den Genderstern dennoch, da er im Schriftbild besser als ein Doppelpunkt oder Unterstrich lesbar ist.
Rund um den Genderstern und die Fragen seiner typografischen wie technologischen Einbettung zeigt sich damit einmal mehr, dass die universalistische Rede von ‚guter Gestaltung‘ unhaltbar geworden ist. Wie auch zahlreiche queer-feministische und postkoloniale Design-Plattformen und -Publikationen zeigen, ist Design situiert und damit weder losgelöst von seinen Produzent*innen, noch von den Adressat*innen zu denken.3 Diversitätskritisches Design braucht also diverse Beteiligte und Perspektiven.
Annika Haas ist Medientheoretikerin und wurde 2022 mit einer Arbeit über Hélène Cixous an der Universität der Künste Berlin promoviert, wo sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte und Theorie der Gestaltung ist. Kooperationsprojekte wie die Medienhaus Lectures 2021 prägen ihre Theoriepraxis an den Schnittstellen von Theorie, Kunst und Gestaltung.
1 Siehe dazu das Gespräch mit der Schriftgestalterin Charlotte Rohde auf diesem Blog: https://criticaldiversity.udk-berlin.de/en/charlotte-rohde/. Gendersensible „Ortho-Typografie“ ist zudem regionalspezifisch, wie die genderfluiden Fonts für französischsprachige Texte von Bye Bye Binary zeigen: https://typotheque.genderfluid.space
2 Massey, Anne. „Design History and Dyslexia.“ Design and Agency: Critical Perspectives on Identities, Histories, and Practices. Ed. John Potvin. Ed. Marie-Ève Marchand. London: Bloomsbury Visual Arts, 2020. 259–272. Bloomsbury Collections. Web. 31 May 2021.
3 Siehe z. B. https://futuress.org/, https://teaching-design.net, https://depatriarchisedesign.com, https://www.decolonisingdesign.com
In Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte fertigte die Künstlerin Ana Tomic eine Serie von zehn Pastellkreide-Zeichnungen an, die jeweils eine Zeile ihres Gedichts „The Lonesome Crowded West” illustrieren. Der Titel ist vom gleichnamigen Album der us-amerikanischen Band Modest Mouse aus dem Jahr 1997 übernommen. In das Gedicht und die Zeichnungen sind dabei ihre Erfahrungen als Teenager und erwachsene Frau, Zitate des Vaters, Darstellungen von Luxus und Erfolg in sozialen Medien, sowie Referenzen auf kanonische Maler wie Caravaggio und Kandinsky eingewoben. Dabei entsteht an manchen Punkten eine interessante Spannung zwischen den autobiografischen Anteilen der Arbeit und den Zitaten aus Kunstgeschichte und Popkultur, an anderer Stelle sind sie wiederum deckungsgleich.Ana Tomic thematisiert in dieser eindrucksvollen Arbeit internalisierte Vorurteile über die eigene Herkunft sowie idealisierte Vorstellungen über die westliche Welt.
Die Arbeit entstand im Rahmen des Seminars Feministische dekoloniale Gesten und Ästhetik, organisiert und durchgeführt von Pary El-Qalqili im Wintersemester 2021/2022 an der UdK Berlin.

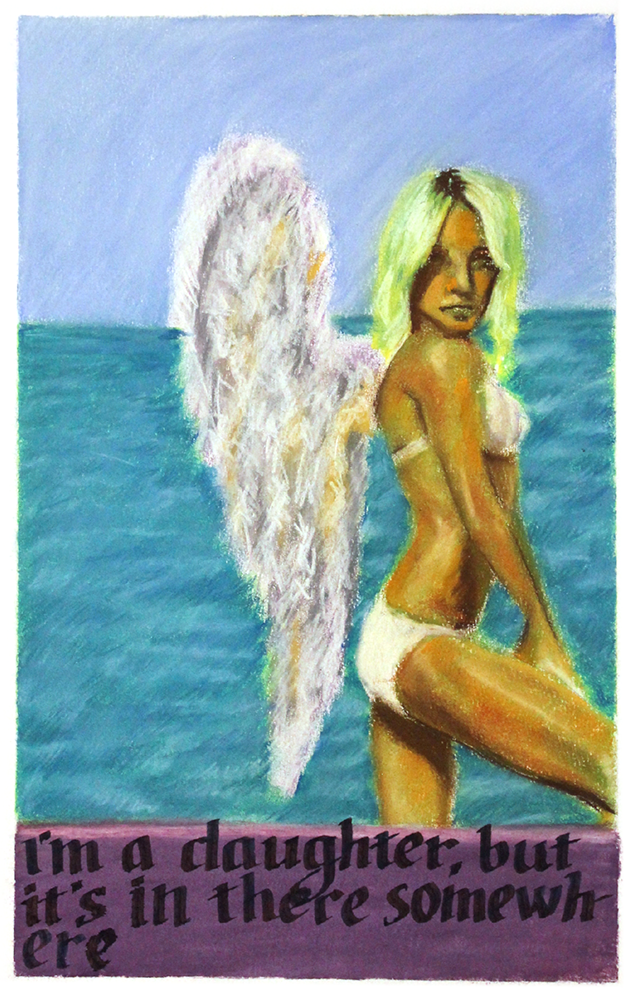
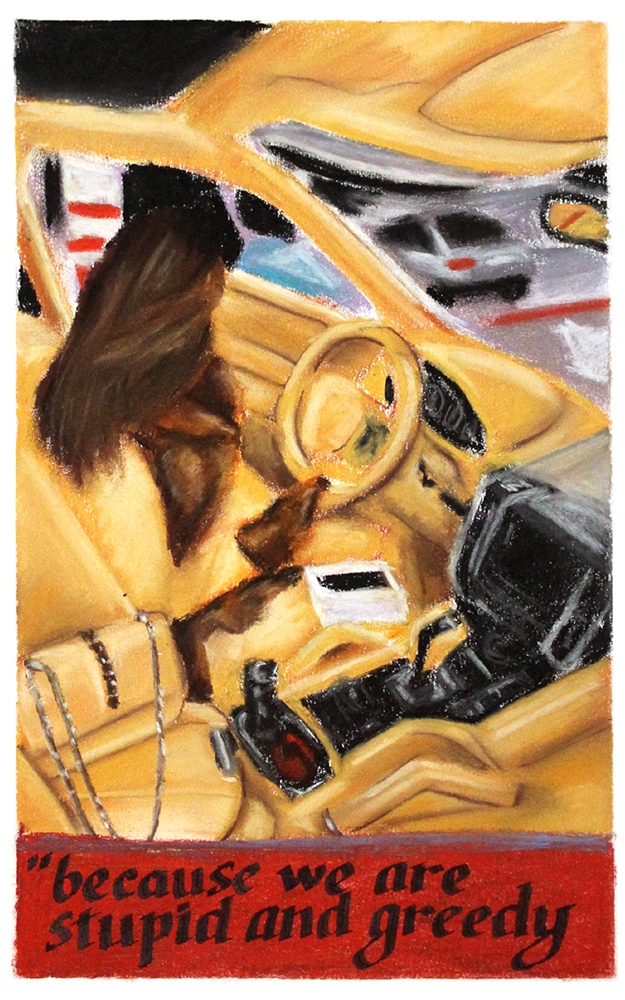
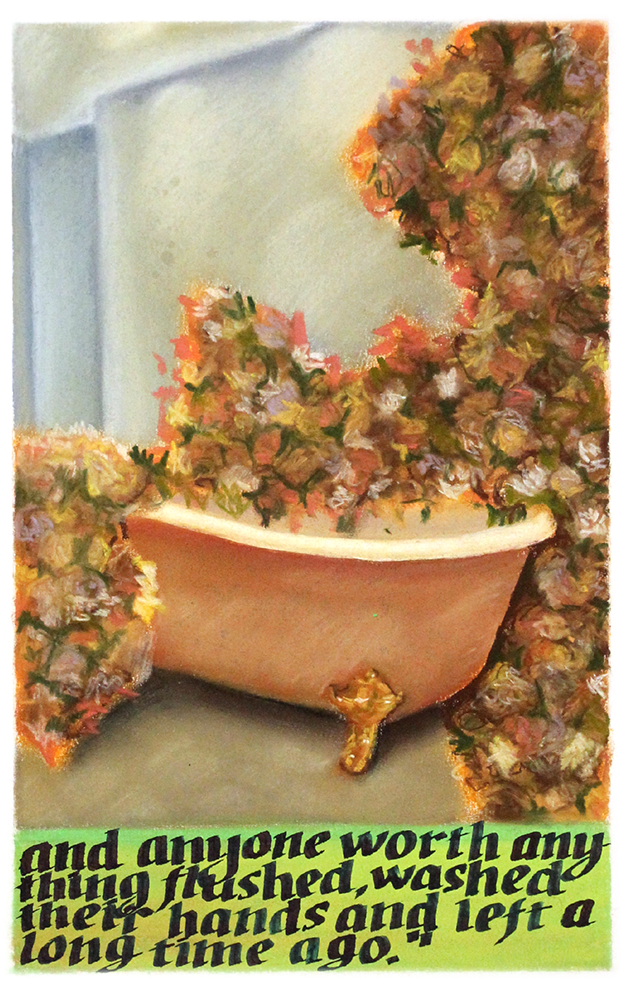

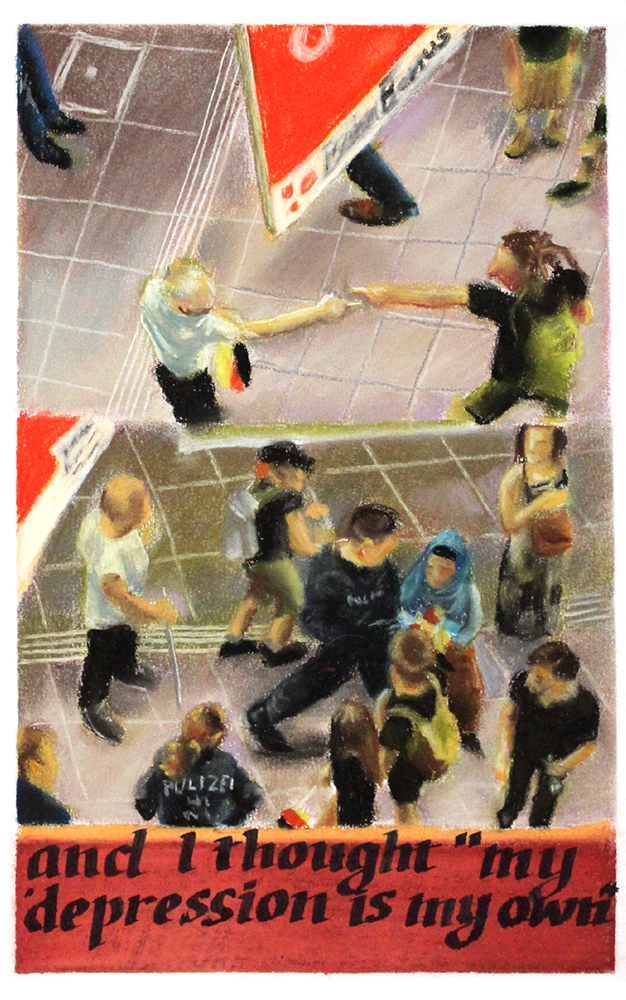
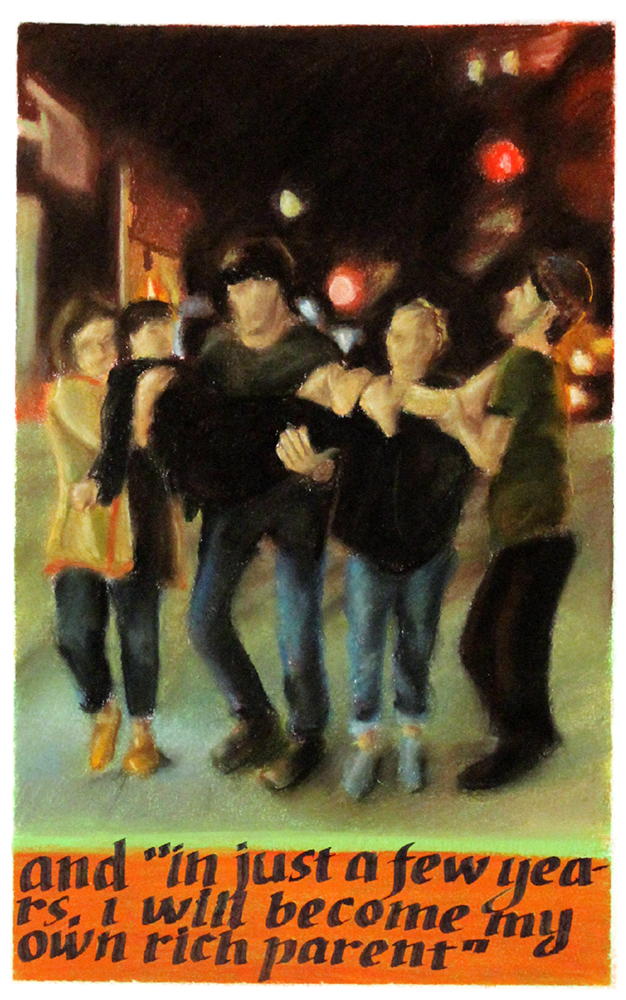
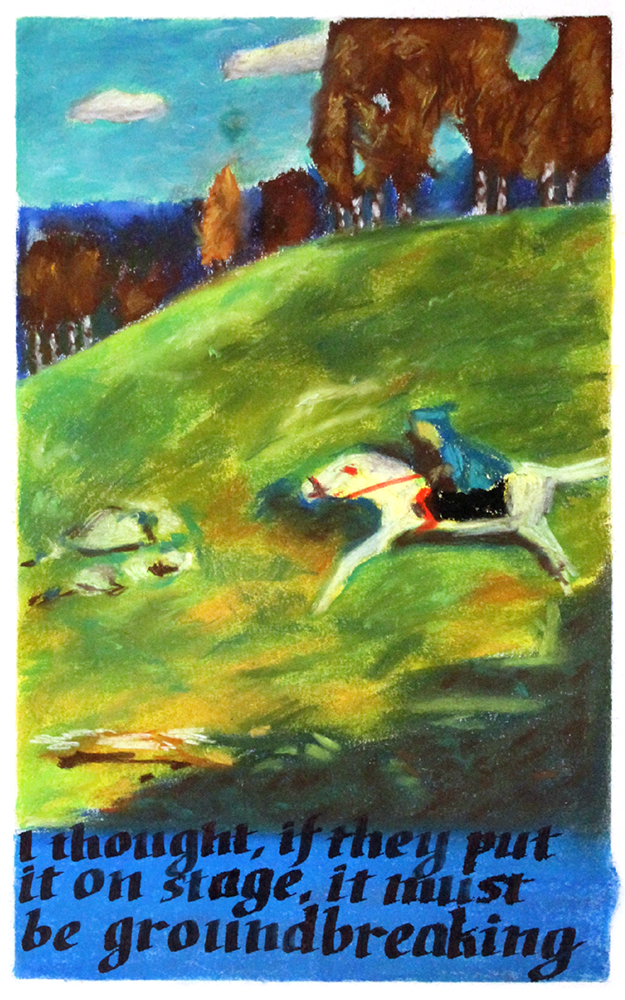
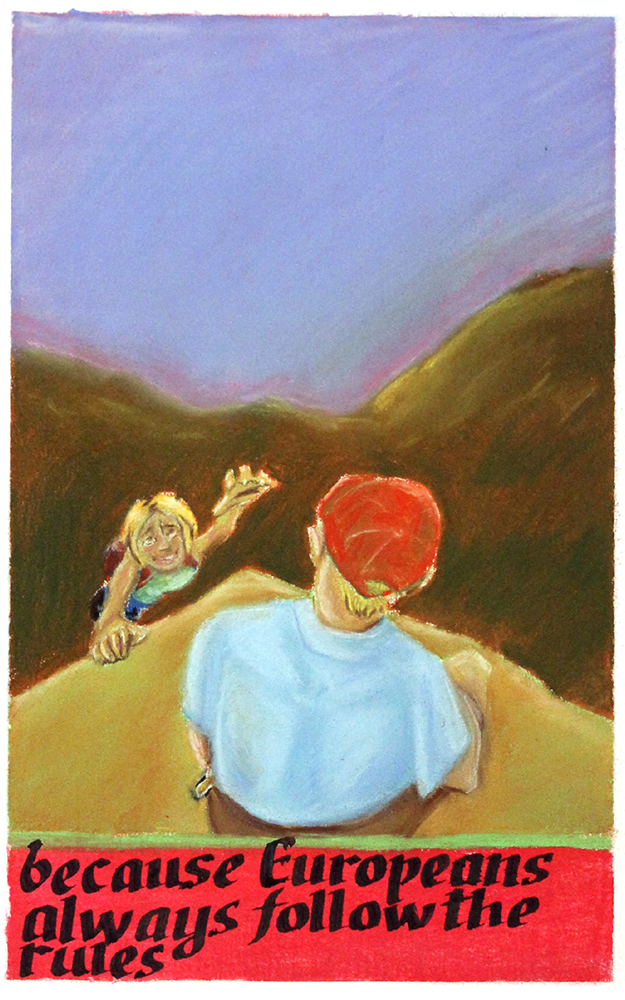

Der Critical Diversity Blog hat neue modulare und interaktive Poster und Sticker, die auch als Flyer benutzt werden können.
Schreibt uns über diversity@udk-berlin.de, falls ihr welche haben wollt!

Charlotte Rohde ist eine Designerin, Schriftgestalterin und Künstlerin, deren Schrift „Serifbabe“ das visuelle Erscheinungsbild des Critical Diversity Blogs maßgeblich prägt. In dieser Folge spricht sie über ihre feministische Arbeitspraxis, über die Verschränkung von Feminismus und Design und über den Entstehungsprozess der Serifbabe.
Im Gespräch werden folgende Links genannt:
Black Type Designers & Foundry Owners
Typefaces designed by Asian womxn
Last year, the student initiative Common Ground at the UdK Berlin launched the Common Ground Studio (CGS), a mentorship program aiming to support disadvantaged people with migration experience ahead of their Fine Art study application. It offered aspiring artists access to one of the classes, as well as assistance during their preparation and application process.
Samet Durgun was one of the seven participants in the inaugural CGS 2020/21 edition, attending the class of Mathilde ter Heijne, along with many online meetings with the group. During this time, Samet further developed his photographic project “Come Get Your Honey” into an eponymous book published in June this year by Kehrer Verlag. He also exhibited the photo series on several occasions, including the group show “Seen By #15. Nothing Ever Happened (Yet)” at the Museum für Fotografie in Berlin.
In this interview with the Common Ground member Adela Lovric, Samet speaks about his project that tells the story of a group of gender-nonconforming, trans*, queer refugees and asylum seekers in Berlin, and his own journey of weaving bonds and friendships with them through vulnerability and joy. Its title—taken from the pop song „Honey“ by Robyn—reflects their shared desire to live better lives while staying true to themselves.
ADELA LOVRIc
Samet, what does your photo series “Come Get Your Honey” aim to show?
SAMET DURGUN
With this photographic story, I aim to broaden what we understand about photographing people who have multiple, historically oppressed identities by challenging the power and relationship dynamics between me—“the artist“—and „the subject.“ I strive to depict everyone as complex human beings in their wholeness while being aware of the limitations of representation.
ADELA LOVRIC
Who are the subjects starring in these photographs?
SAMET DURGUN
They are the people I bonded with, who are queer, trans, gender-nonbinary refugees and asylum seekers from Berlin. As a side note, I prefer not to use the word ’subject‘ as I strive to close the gap between the artist, the viewer, and the people in front of the camera.

ADELA LOVRIC
What other term would be more fitting than ’subject‘? Does ‚protagonist‘ work in this case?
SAMET DURGUN
It could be words such as ‚person,‘ ‚individual,‘ ‚people,‘ or anything that reminds us that they are human beings. The way I see it, ‚protagonist‘ is an alienating term that better fits fictional characters in movies, plays, or novels.
The artist Martha Rosler says: „[T]he ’non-artist‘ art world prefers art that doesn’t direct their attention to the now … They prefer to see it as something that helps them move away from concerns of the everyday … Art has an obligation to speak to people about the conditions of everyday life, not necessarily to make them feel insuperable, quite the opposite, to remind them that they are engaged citizens.“
Even if art, especially photographing people, might seem close to „the now“ and appreciated for it, the power dynamics in photography are still rigid, therefore serving the viewer’s old expectations. I want to create art that makes non-artists feel neither insuperable nor superior.
ADELA LOVRIC
Can you tell me more about these people and your relationship with them?
SAMET DURGUN
The first person I’ve met was Prince Emrah, a gender-nonbinary (she/he) refugee from Turkmenistan and a figure known in the Berlin underground performance art scene as a belly dancer. Back then, she formed a collective called House of Royals, which provides space and champions BIPOC LGBTQIA+ artists, especially refugees and asylum seekers. Against all odds, Emrah was doing truly trailblazing work, and he was kind enough to accept my request to photograph him for a photo series I was doing at the time. From that portrait session, we grew a friendship. I was able to support the collective with photos while spending time with them and to develop my aesthetics and artistic process.
On one of the show days, Emrah introduced me to a close group of friends with whom she used to share a dorm. That day I met Reza who encouraged me to tell their story and opened the doors of the dorm for me. My visits became regular and relationships got closer; friends introduced me to their friends. I got to know an incredibly diverse group of queer individuals, in and outside the dorm, from countries like Russia, Syria, Serbia, Afghanistan, Nigeria, Iran, Malaysia, Yemen, Libya, and Turkey.
During those meetings, their stories felt extremely close to me. There it was, a group of people I was more comfortable with than most people I’ve met in my entire life. Every gender-nonconforming, trans*, and queer individual had a different story, a different origin, a different way of living in Berlin, and different plans for the future. Yet there was an understanding for each other, a sense of relief.


ADELA LOVRIC
The photos are very tender and intimate; they imply an atmosphere of trust. Can you tell me about the process of making them and your intentions behind this kind of up-close approach?
SAMET DURGUN
During my visits, we talked a lot about how we like it in Berlin and how we are doing now. Those were the moments when I was impressed by the warmth, kindness, and resilience I witnessed.
The up-close approach allowed me to eliminate most of the visual clues of the physical space. The viewer is left with the person in front of them, and the rest is up to their imagination. There are fewer elements to be used to perpetuate what we assume about a person or a community. There are also multiple portraits of the same individuals.
As a person who sits in the middle of many historically oppressed identities, I have formed a ’superpower‘ to perceive who is looking down on me. Thus I asked myself a fundamental question while photographing the individuals: „Whose gaze am I going to serve?“
I try my best to disengage from artistic and journalistic storytelling made merely out of curiosity, saviorism, pity, or toxic masculinity; narratives that are pervasively melancholic, objectifying, mystifying, sensationalizing, or brutally simplifying, thus ultimately dehumanizing.
ADELA LOVRIC
So, this is the gaze you’re actively not serving. To borrow your question—whose gaze are you serving with these works?
SAMET DURGUN
The people I photograph first. And then those who are aware of the pitfalls of today’s storytelling and willing to expand their perception.


ADELA LOVRIC
You yourself are not part of the depicted community. Why was it important for you to focus on its members?
SAMET DURGUN
Before becoming a permanent immigrant (recently, a German citizen) in Berlin, I came here in 2010 for a summer internship, and I fell in love with the city. The only choice I had back then was to live in Istanbul, and I knew that deep down, I would never feel comfortable living there just being myself.
I grew up watching legendary trans*, gender-nonconforming, and other queer artists on TV, but they seemed from another planet. Until my mid-twenties, no one ever told me their gender identity or sexual orientation—neither did I to anyone! While my friends didn’t owe me an „outing,“ it was very lonely. At the same time, I was always sure that we were plenty (according to a Gallup survey, 15% of the Gen Z in the US identify as queer). Over the years, I had openly gay friends, but the invisibility of the other letters of LGBTQIA+ carried on.
I have so many identities that make me belong to several communities and none of them at the same time. My mom brought us up by comparing us to the mother and the father’s side. Men and women in the big family ate in different rooms when gathered together for holidays; guess which side I was on. I’ve learned about the forced displacement my forebears went through only by reading books. People often questioned if I was a minority in my hometown because of my pale skin, „too thin” bones, and off-accent. My manager in Berlin once asked me at a party if I was drinking water because I am Muslim. I didn’t tell him that I am agnostic.
To clarify: I am not counting all these to justify my connection with „the community.“ In contrast, when there are so many intersections in someone’s identity, I look for what connects us—a common ground—rather than what separates us, as there will never be a proper match. As far as the book’s context is concerned, I belong to a group of individuals in Berlin who deeply knew they had to find a new home because of their gender or sexual identity. With the power of the community, I am able to connect to a bigger consciousness than myself.


ADELA LOVRIC
How were your ideas, approach, and the final result received by the people you photographed?
SAMET DURGUN
Sometimes ideas came up while in a casual stillness, preparing for a show, or in the middle of cooking. There were also times when I would come up with a concept and visit a particular person. We would discuss the feasibility and drop the idea if necessary. There were times the idea was too personal to show it in a book. I wanted to make sure everybody was comfortable with what they present. Mirna, a hairdresser, asked me to take a picture while she was whipping her hair—she said she had gotten new fancy extensions. On the same day, she pulled out a huge pack of chips from under her bed. We also made pictures of her tying that with a belt, looking like a dress. One of those two ideas made it to the book.
One of the last steps in forming the book was to interview Prince Emrah, who would ask me anything. I showed all the pictures which will be in the book. During our talk, she said she remembers my self-portraits in full-blown makeup and a belly dance costume, which I didn’t include. He suggested including them since they deserve a spot. After cross-checking with a couple more people from the book, those pictures became a part of it.
ADELA LOVRIC
This reversal of roles you experienced with Prince Emrah and the interview that resulted seems like a very significant moment in the process. What did this shift of dynamic between you and this self-portrait, chosen by Emrah, mean to you in the context of this photo series?
SAMET DURGUN
The dynamic of the gaze has always been a mix from the first moment. When people are involved in photographic work, it is necessary to acknowledge their power. By acknowledging, I don’t mean to „provide space;“ I mean accepting that there is participation. People pose for me, and even if they don’t, they see the photos afterward. Communication and collaboration go hand in hand.
Two self-portraits were also a fruit of this collaboration, another way of expressing my subjectivity. Thus Emrah’s suggestion was a warm welcome; he understood my good intention and will to visualize my participation.
One picture came to life when I borrowed his dress during a show night. His dresses are puzzling even the belly dancers in Turkey, where he lived for a few years before arriving in Germany. She mixes traditionally gendered costumes or rather removes the gender from them. Her clothes are the representation of gender fluidity, thus a fashion statement.
I made the second self-portrait after a makeup workshop session in the dorm. I was there to witness the occasion, and I was asked if I also wanted to participate. One of the friends I knew from House of Royals saw my raw craft and decided to paint me. She certainly did not need that workshop; she just happened to be there and wanted me to look good. I was mesmerized by this interaction, so I had to record this moment. We came to her kitchen during sunset. Her shadow is now present in the picture—both metaphorically and literally.

ADELA LOVRIC
„Come Get Your Honey“ is not just a series of photographs but also a photobook containing quotes, interviews, voice and video recordings, and a link to the website where the audience can access and read the backstories of some pictures. Can you tell me more about this part of the work and explain why you chose this way of portraying this community instead of limiting it to purely pictorial content?
SAMET DURGUN
The idea sparked while showing an early selection of images to Marianne Ager, the curator who wrote the outro for the book. She asked me whether I had videos. My immediate response was “no,” but that question stayed with me. Why was I stuck to the images, although there was so much more to offer?
Perhaps because very few authorities define my taste and hold too much cultural, economic, and political—thus decisional—power. Or maybe I wish to make perfect sense of what I see because it is a photograph. If I think about music, a much more decentralized and mature art form, there are more than 5000 genres. How many photography genres can you count? When I listen to 800 different genres, why should my photography fit one?
Over time, I started seeing photography more as a means than a medium. I remind myself to let go of certain expectations of the medium and form relationships with different elements to enrich my stories, so that people discover, unfold, feel closer, and engage more.
ADELA LOVRIC
And lastly—has this project had any sort of direct impact on this community or on you personally?
SAMET DURGUN
Two people featured in this photo series came to me and asked for a copy of the book to share with their lawyer because both of them, separately, heard that this could be useful as proof for their case of getting a refugee status. The biggest issue asylum seekers face in Berlin, or probably everywhere else, is that the authorities are not convinced by their story. That is why getting refugee status sometimes takes weeks or even years. For these people, in particular, it’s been taking a long time. I can’t say yet if this was of any help because they didn’t get their refugee status yet, but they’re in the process. I never thought this could be something helpful in this sense but I hope it will be.
I have also been personally affected as this is my “coming out” to many of my relatives besides my core family and friend group. Whoever goes to my Instagram now can see me in a belly dance costume. So, on a personal level, it was not just about my self-expression but also about finding my confidence and being brave.
Sickness Affinity Group (SAG) is a group of art workers and activists who work on the topic of sickness and disability and/or are affected by sickness and disability. Rowan de Freitas, an artist studying at the Institute for Art in Context, had a conversation with Laura Lulika of SAG about art production, sickness, and disability as well as institutional barriers and support. The conversation took place in the seminar “Critical Diversity – Projects and Productions” at the Institut für Kunst im Kontext.
Production: Nina Berfelde, Rowan de Freitas, Jisu Jong and Svenja Schulte, Art in Context.
Oder: Nieder mit dem Advocatus Diaboli
Einer Person of Colour begegnen ein Leben lang weiße Menschen, die auf unterschiedliche Weise über das Thema Rassismus reden wollen. Eine Form, die mir besonders häufig begegnet und durch ihre tückische Beiläufigkeit auffällt, ist eine männlich kodierte Position des Bescheidwissens oder des Mansplainings: genauer die des weißen Mannes, der gerne Advocatus Diaboli, den Anwalt des Teufels, spielt.
Die Erfahrungen und die Lebensrealität von Betroffenen werden von ihm als rein theoretisches Gedankenexperiment behandelt – denn diese Probleme sind für den Außenstehenden nur theoretisch, nicht realistisch erfassbar. Es macht ihm Spaß, über die Rechte und Existenzen von PoC zu diskutieren: „Lasst uns darüber sprechen, warum euer Existenzkampf diskutabel ist.“ Die tatsächlichen Probleme sind für ihn wie ein Spielball, denn sie betreffen ihn nicht. Er kann es sich leisten, sich munter über Definitionen von Rassismus zu äußern, denn er erfährt die Müdigkeit, die emotionale Arbeit, das Trauma und die Diskriminierung hinter dem Begriff nicht am eigenen Leib.
Rassismus-Debatten werden von ihm aufgegriffen, um die eigene vermeintlich kosmopolitische Fortschrittlichkeit und Belesenheit zur Schau zu stellen. Vielleicht auch, weil er einem „aktuellen Trend“ folgen will. Ohne Bedenken übergeht er die Lebensrealitäten von PoC sowie die gewählten Mittel, mit denen Betroffene ihre Erfahrungen kommunizieren. Aus purer (Schaden-)Freude an der Diskussion wird eine problematische Aussage in den Raum geworfen, nur um sich anschließend unter dem schützenden Mantel von „Zu einer Diskussion gehören auch Gegenmeinungen“, „Das darf man ja wohl noch sagen dürfen!“ und „Meinungsfreiheit“ zu verstecken. Unter diesem Deckmantel liegt die Tücke des Phänomens: Betroffene erkennen den Typus nicht immer sofort, doch lesen die Situation als äußerst unangenehm. Womöglich realisiert man nicht richtig, wieso man sich so herabgewürdigt fühlt. Es ist doch nur eine wissenschaftliche Debatte, alles komplett objektiv – oder?
Dass der Außenstehende am Ende ausweicht, in passiv-aggressive Defensivhaltung verfällt und seine problematischen Aussagen als rein hypothetische oder gar wissenschaftliches Gedankenexperiment bezeichnet, gehört dabei zur gängigen Technik. Wichtig ist hierbei zu betonen, dass es ihm nie darum geht, zu lernen oder das eigene Wissen zu erweitern. Ganz im Gegenteil: Er will Dinge beim Alten belassen, denn er profitiert vom aktuellen Status Quo. Das Ziel des weißen Mannes in dieser Situation ist es, seine eigene Überlegenheit und Deutungshoheit zur Schau zu stellen. Das Wichtigste ist, dass ihm weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt wird. Insbesondere dann, wenn er ausnahmsweise einmal nicht im Zentrum steht.
Was passiert also, wenn Betroffenen wieder und wieder darauf hinweisen, dass sie von diesen Gedankenexperimenten verletzt werden? Was passiert, wenn sich zahlreiche Stimmen von PoC gegen diese demütigenden Diskussionen erheben?
Leider nur wenig. Uns wird Emotionalität, Empörung und fehlende Empirie vorgeworfen, welche im krassen Gegensatz zur Wissenschaftlichkeit und Rationalität des reinen Beobachters ständen. Wenn wir uns nicht auf eine Fortführung der Gespräche einlassen und keine kostenlose Bildungsarbeit leisten möchten – sei es aus Erschöpfung, Angst, Zeitmangel, fehlenden Ressourcen oder sonstigem Grund –, wird uns vorgeworfen, nicht offen zu sein und keine ertragreichen Diskussionen zu wollen. Die Schuld liegt nie bei demjenigen, der Erfahrungen in Frage stellt, sondern immer bei denjenigen, die sich nicht für die Evidenz ihrer traumatischen Erfahrungen rechtfertigen wollen. Das bringt mich zur Frage: Wie reden wir über und mit Betroffenen?
Ich habe diese Spielchen satt. Wer tatsächlich im Fokus stehen sollte, sind Menschen, die Rassismus erleben. Ihre Erfahrungen und Perspektiven sind viel wertvoller für unsere gesellschaftliche Entwicklung, als es eine polemische Debatte, ob diese Erfahrungen überhaupt real sind, jemals sein könnte.
Christina S. Zhu arbeitet als Illustratorin und studiert im Master an der UdK Berlin. Sie engagiert sich für intersektionale Antidiskriminierung und ist Referentin für Antidiskriminierung des Inneren im AStA, Mitglied der studentischen Initiative I.D.A. und der AG Critical Diversity.
„Das ist so kitschig, das würde sogar Erdoğan gefallen“, sagte mir ein alter weißer Mann, der an der HfG Offenbach1Die Hochschule für Gestaltung Offenbach bietet die Studiengänge Kunst und Design an und genießt mit einem aufwendigen Aufnahmeverfahren und etwa 750 Studierenden einen hervorragenden Ruf. als Professor für Markenstrategie unterrichtete. Als ich mich 2017 an deutschen Kunstuniversitäten bewarb, wurde ich mit autoritären Machtdemonstrationen, Rassismus, Sexismus und toxischer Männlichkeit konfrontiert – und stelle mir nun die Frage, inwiefern die Strukturen von Kunstuniversitäten pädagogisch verändert werden müssen, um solchen Dynamiken entgegenzuwirken.
Bevor es überhaupt losging
Um sich für den Studiengang Kunst an der HfG Offenbach zu bewerben, braucht es Zeit: Für die Bewerbungsunterlagen, ein Portfolio mit mindestens 30 Facharbeiten, die künstlerische Eignungsprüfung und mehrere Mappensichtungen im Voraus, die dringend empfohlen werden. Dort schauen sich Professor*innen der Hochschule vor anderen potentiellen Bewerber*innen die Mappen an und sollen eigentlich konstruktives Feedback geben. Bei solch einer Mappensichtung befand ich mich 2017 und wartete, bis ich dran war. Vor mir bewarben sich Menschen mit Abschlüssen von verschiedenen Kunstakademien und zeigten ihre Werke und Lebensläufe. Der zuständige Professor jedoch machte sich genüsslich über die Deutschkenntnisse von Bewerber*innen lustig, anstatt eine Einschätzung oder Kritik der Arbeiten anzubieten: Er fragte eine Südkoreanerin, wieso die Illustrationen denn nicht im Manga-Stil gestaltet wurden. „Manga passt doch so gut zu dir“, bemerkte er. Ihre Fotografiearbeit zu Rotweinsorten wurde kommentiert mit „Gibt’s bei euch in Korea überhaupt Wein?“ Einer anderen Person sagte er „Das ist ja so bedrückend wie euer China“, woraufhin diese konterte: „Ich bin aus Japan.“ Während die Arbeiten von männlich gelesenen Personen mit unkommentiertem Kopfnicken bestätigt wurden, mussten sich viele Bewerberinnen solche Sticheleien anhören.
Und nun war ich dran – meine Gefühlslage war eine unangenehme Mischung aus Nervosität und unterdrückter Wut. Bevor es überhaupt losging, fragte er mich penetrant nach meiner ‚Herkunft‘ – meine Antwort „Ich bin aus Frankfurt, gleich hier um die Ecke“ reichte natürlich nicht. Nach einer Weile gab ich nach. „Aha“ antwortete er, und während des Sichtens meiner Mappe wiederholte er dann viermal: „Das ist so langweilig, so kitschig, dass es sogar Erdoğan gefallen würde“ und schaute mich provokant an. Es war der Teil meiner Mappe, welcher nicht der ,westlichen‘ Ästhetik entsprach. „Das hat doch gar nichts mit Kunst zu tun“ sagte ich perplex. „Ja, genau deswegen“ antwortete er willkürlich.
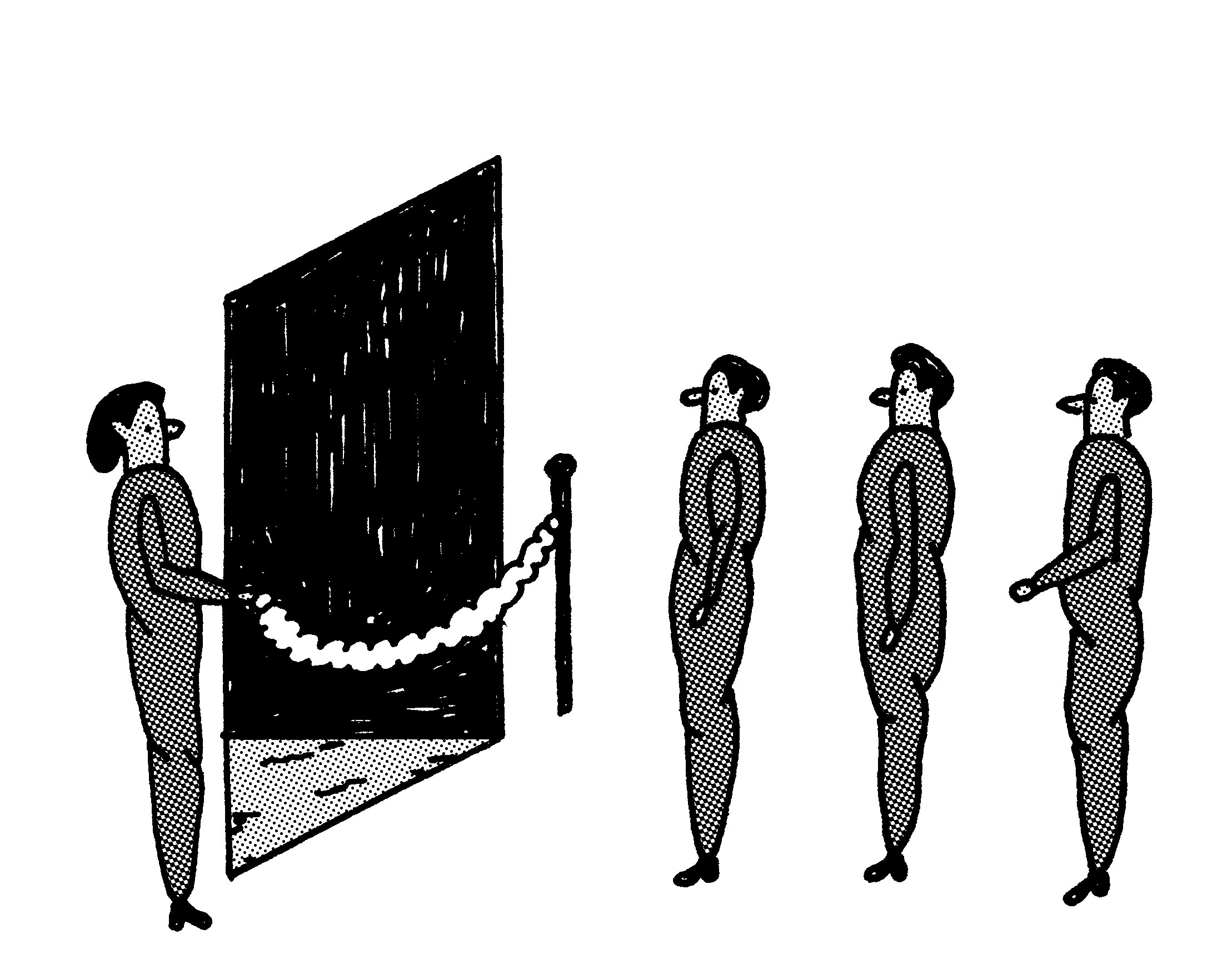
Eine falsche Assoziation, die im Übrigen (unabhängig von der diskriminierenden Aussage) nicht einmal auf meine Familiengeschichte und Antwort zutrifft. Ich erinnere mich, dass ich trotzdem den gesamten Rückweg „nicht weinen, nicht weinen, nicht weinen“ in meinem Kopf wiederholte. Und darauf folgend: „Wieso habe ich nicht besser gekontert oder wenigstens den Anderen geholfen?“ Peinlich berührt realisierte ich, dass ich nach diesen Machtdemonstrationen keine Zivilcourage geleistet habe, weil ich einen guten Eindruck hinterlassen wollte, um an der Universität angenommen zu werden. Mein zukünftiger Studienort als auch die Bewertung meiner Arbeiten hingen davon ab, wie er mich wahrnimmt: Ich rebellierte nicht, um nicht als wütende Migrantin abgestempelt zu werden.
Diese Dynamik funktionierte, da sich der Professor als einzige Person im Raum zu den Arbeiten äußern durfte – nach anderen Meinungen wurde weder gefragt, noch waren sie erwünscht. Von seinem privilegierten Standpunkt aus spielte er mit der Unsicherheit der Bewerber*innen: Die hierarchische Situation wurde für vermeintliche Witze und unprofessionelle Bemerkungen genutzt. Welcher Ästhetikbegriff hierbei eine Rolle spielte, wurde durch das Betonen der assoziierten ‚kulturellen‘ Zugehörigkeit ebenso klar: Deine ‚Herkunft‘ bestimmt über deine Mappe, und nicht andersherum. Entweder passt du zur HfG, oder deine Arbeit ist zu ‚fremd‘ und ‚kitschig‘.
Von Zuschreibungen und Betroffenheit
Die Vorstellung, als etwas abgestempelt zu werden, oder auch Sich-Denken-Was-Der-Andere-Von-Einem-Denkt, öffnet die Büchse des internalisierten Wahnsinns. Hierbei werden nicht nur die eigenen politische Haltungen, sondern auch Emotionen unterdrückt oder hinterfragt. Das Dilemma, sich von zugeschriebenen Rollen (hier: die wütende Migrantin, die keine Abweisung verkraften kann) zu distanzieren und zugleich antidiskriminatorische Arbeit leisten zu wollen, beschreibt Sara Ahmed mit der Figur des Feminist Killjoys: Eine Spielverderberin*, die, egal wie sie spricht, als Feministin* wahrgenommen wird, die ständig Probleme verursacht. Und dadurch selbst das Problem verkörpert.2Ahmed, Sara: Living a Feminist Life, Duke Univ. Press (2017)
Am Beispiel der Mappensichtung in Offenbach – wie auch in vielen anderen Fällen – ist aber der zu beachtende Punkt, dass von Diskriminierung Betroffene nicht die Pflicht tragen, den*die Täter*in zu konfrontieren. Denn letztere haben in den Strukturen der Kunstuniversitäten die Möglichkeiten, ihre Macht und Überlegenheit zu demonstrieren – und das nutzen sie oftmals auch. So entsteht eine Wissenshierarchie, in der überwiegend westeuropäische Künste wertgeschätzt und legitimiert werden. Wenn Lehrende eine ästhetische Sprache auferlegen, reproduziert das weiterhin die bestehenden Strukturen, was bei Lernenden negative Folgen im Studienalltag auslöst. Laut Ira Shor zählen dazu Selbstzweifel, Empörung, Frustration und Langeweile: „These […] are commonly generated when an official culture and language are imposed from the top down, ignoring the students’ themes, languages, conditions, and diverse cultures.“3Shor, Ira: Empowering Education: Critical Teaching for Social Change (1992) 23
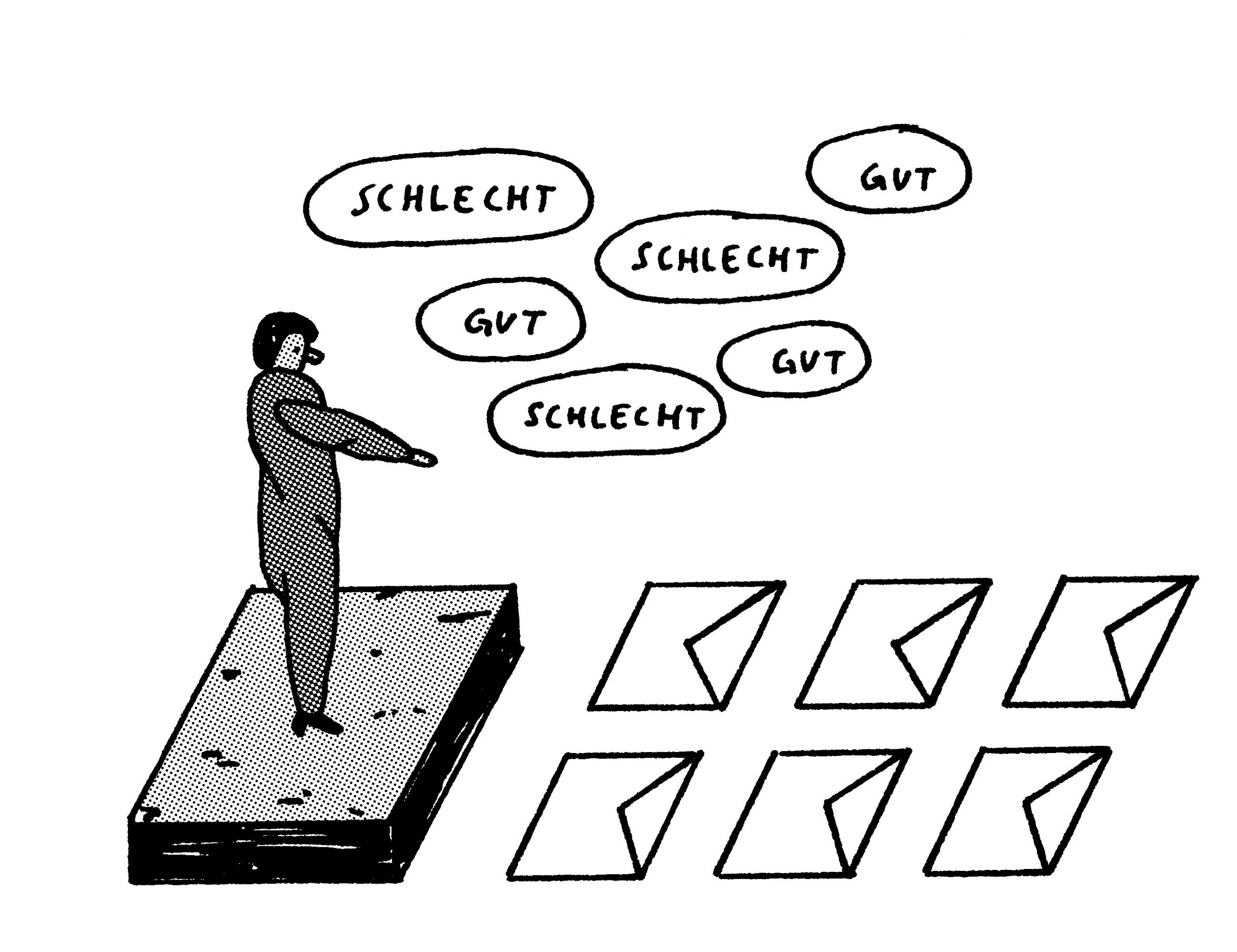
Das unbenannte Vorwissen und Verständnis einer ästhetischen Sprache formulieren sich unter anderem wie folgt: „Diesen Künstler müssten Sie aber kennen!“ Es wird angenommen und vorausgesetzt, dass Studierende ähnlich sozialisiert sind wie Lehrende, sei es eine vergleichbare Bildungssituation oder ein bestimmtes Kunstverständnis und ‚Allgemeinwissen‘. Dies äußert sich oft durch Abfragen von Referenzen bis hin zur ästhetischen Wertung, deren Begründung oftmals nicht genau benannt werden kann. Der Standpunkt, der hier als lehrende Person eingenommen wird, ist geprägt durch die eigene Bewertung und Wahrnehmung von Künsten.
Diese unausgesprochenen Normen können nur jene verstehen, die auch in einem spezifischen kulturellen und akademischen Kontext aufgewachsen sind, wodurch sich die Bildungsungleichheit verstärkt. Gerade Kunsthochschulen, die sich als zukunftsorientiert, vielseitig und offen verstehen, bestärken diese Dynamik durch fehlende transkulturelle Kompetenzen.
Dass Studierende of Color besonders betroffen sind in von Diskriminierung geprägten Situationen, zeigen die vielen anonymen Rassismuserfahrungsberichte, die an der Universität der Künste Berlin im Rahmen der Protestaktion #exitracismUDK gesammelt und an den Universitätsfassaden4exitracismUdK ist ein offener Brief mit formulierten Forderungen an die Universität der Künste Berlin, und eine Antwort auf die „mangelnde Solidarität von Seiten der Lehrenden.“ https:// … Mehr anzeigen gezeigt wurden. So schrieb ein*e Queer Student of Color: „Den Lehrenden fehlte es an emotionaler, pädagogischer, sowie (trans)kultureller Sensibilität.“5Ausschnitt eines Erfahrungsberichtes, welcher durch exitracismUdK in der UdK-Ausstellung KUNST RAUM STADT am 16-17.7.2020 gezeigt wurde. „2018 wurde ich für den Master an der UdK angenommen. … Mehr anzeigen
Die Vorstellung, dass lediglich Betroffene die Aufgabe tragen, Diskriminierungen zu behandeln oder aufzuarbeiten, funktioniert nicht: Es ist ignorant und verwerflich, sich der Verantwortung zu entziehen, bestehende Strukturen weiterzuführen – und von ihnen zu profitieren. Denn nach bell hooks6bell hooks ist Literaturwissenschaftlerin, Professorin, Aktivistin und Autorin intersektionaler, anti-rassistischer und feministischer Bücher. ist Bildung politisch und findet in einem spezifischen politischen Kontext statt, verbunden mit einem politischen Ziel, auch wenn dieses nicht explizit hervorgehoben wird.7Kazeem-Kamiński, Belinda: Engaged Pedagogy: Antidiskriminatorisches Lehren und Lernen bei bell hooks (2016). Lehrende treffen politische Entscheidungen, wenn sie lehren, was im Kontrast zu dem verbreiteten Bild einer objektiven und universellen Bildung steht.

Ein Beispiel nehmen an bell hooks
bell hooks formuliert hierbei pädagogische Praktiken, die auf8ebd. Lehrende sowie Lernende zutreffen: Das Bewusstsein davon, dass Bildung politisch ist und dass politische Entscheidungen getroffen werden, was und wie gelehrt wird; die Anerkennung davon, dass der gesellschaftliche Kontext diskriminierende Strukturen aufweist; und das kritische Hinterfragen der eigenen Position.9Eine Positionierung in bestehenden Machtverhältnissen können Angaben zu unter anderem Geschlechtsidentitäten, sexuelle Identitäten, Behinderungen, Rassismuserfahrungen oder ökonomische … Mehr anzeigen Denn Bildung kann und sollte auch ein Werkzeug sein, um Rassismus, (Hetero)sexismus, Ableismus, Antisemitismus und viele weitere Diskriminierungsformen zu überwinden: Indem es zu einer Auseinandersetzung kommt und internalisierte Vorstellungen aufgebrochen werden, geht der Raum des Lernens über die Wissensaneignung hinaus. Im ‚participatory space‘, also einem Raum, in dem die Teilhabe jeder*jedes Einzelnen möglich ist, wird kritisches Denken trainiert. Das bedeutet auch, dass im Gegensatz zur häufigen Forderung, objektive Fakten zu nutzen, auch individuelle Erfahrungen anerkannt, wertgeschätzt und nicht von der Theoriearbeit getrennt werden. Erst daraus können wertvolle Diskurse und eine feministische, antirassistische, dekoloniale und antiklassistische Lehre entstehen. Kurz: eine kollektive, kritische Praxis.10Kazeem-Kamiński, Belinda: Engaged Pedagogy: Antidiskriminatorisches Lehren und Lernen bei bell hooks (2016)
Design, aber dekolonial.
Im Kontext der Kunstuniversität bedeutet eine kollektive, kritische Praxis auch das Überdenken der Lehrinhalte. Diskurse um Künste, Ästhetik und Design müssen unter anderem antirassistisch, feministisch und dekolonial neu gedacht werden. Das kann nur geschehen, indem sich zuerst mit der (vor allem kolonialen) Geschichte auseinandergesetzt wird, um sie zu reflektieren und in der Lehre widerspiegeln zu lassen. Danah Abdulla erklärt, dass der Designbegriff als kontextbasierte, sich ständig entwickelnde Praxis verstanden werden muss11Abdulla, Danah: Design Otherwise: Towards a locally-centric design education curricula in Jordan (2017) – und nicht als Ergänzung für eurozentristische Kategorisierungen. Das bedeutet also nicht nur eine Erweiterung und das Hinterfragen des Lehrmaterials oder der Referenzen, sondern auch das geschichtliche Aufarbeiten und Benennen des eigenen Standpunkts: Alle sind ein Teil der Praxis der Aufrechterhaltung bestehender Machtverhältnisse – und deswegen geht es auch alle etwas an. Inwiefern das im Designkontext aufgearbeitet werden kann, zeigt die Forschungsgruppe Decolonising Design12Decolonising Design ist eine Forschungsgruppe, die analysiert, in welchen kolonialen Strukturen Gestaltung und Design agieren. (https://www.decolonisingdesign.com/) sowie Open Source13Teaching Design ist eine Open Source Bibliografie mit dem Fokus auf Designvermittlung in der Bildung aus intersektional-feministischen, dekolonialen Perspektiven. (https://teaching design.net/) Bibliografien wie Teaching Design oder Decentering Whitenes14Decentering Whiteness in Design History Resources ist eine Open Source Bibliografie, die von Designgeschichtsdozent*innen erstellt wurde als Reaktion auf die Forderungen der Studierenden, … Mehr anzeigen in Design History Resources.
Diese (oftmals von BIPoC aufgearbeiteten) Informationen sind ausreichend vorhanden – die Frage ist nur, wann und wie sich Kunstuniversitäten aufrichtig selbstkritisch reflektieren und pädagogisch neu positionieren, jenseits des oberflächlichen Diversity-Images.

Was wäre wenn?
Wenn ich an die Situation an der HfG Offenbach denke, formuliere ich viele Was-Wäre-Wenn-Überlegungen, denn in diesem Raum haben allein in einer Stunde etwa sechs Menschen Rassismus und Sexismuserfahrungen gemacht, ausgehend von einem einzigen Professor. Weder seine studentische Hilfskraft neben ihm, noch der andere Professor im selben Raum haben interveniert oder widersprochen, trotz ihrer privilegierteren Position als weiße cis Männer. Wenn der Raum partizipativer gewesen wäre, hätten mehr Menschen auf die Werke reagieren können, wodurch sich die Wissens- und Machthierarchien verschoben oder sogar aufgelöst hätten. Im Falle von diskriminierenden Äußerungen hätten sich nicht nur mehr Menschen wohlgefühlt, zu reagieren – idealerweise hätte sich der Täter nicht wohl gefühlt, diese überhaupt zu äußern. Der Professor wäre vielleicht auch nie berufen worden. Kein „Wo kommst du her“ und „Ihr macht das dort drüben doch so“ oder „Mach das mal, das passt doch so gut zu dir“, keine unterdrückte Wut, Unwohlsein und sich Hinterfragen auf dem Rückweg nach Hause. Und vor allem auch keine kreativen Hemmungen, die sich durch das gesamte Studium ziehen15Als mittlerweile zugelassene UdK-Studentin musste ich erleben, dass der Studienalltag von patriarchaler Hierarchie geprägt ist und von eurozentristischen Bewertungen abhängt, die umso … Mehr anzeigen, weil die eigene Praxis ständig mit Ästhetikdefinitionen verglichen wird, die man sich zähneknirschend aneignet, um mitreden zu können.
Was wäre also, wenn die Lehrenden an deutschen Kunstuniversitäten all diese Bauhaus-Referenzen16Die Kunst- und Designschule Bauhaus war 1919-1933 aktiv, der Einfluss auf deutsche Kunsthochschulen bleibt weiterhin stark: In meinem Studium der Visuellen Kommunikationwurde ich in vielen Seminaren … Mehr anzeigen in ihrer Lehre mit Werken von BIPoC Künstler*innen, Gestalter*innen und Wissenschaftler*innen ersetzen würden? Oder anders: Was wäre, wenn die Präsenz der sogenannten ‚Bauhaus-Frauen‘ nicht als Frauengleichstellung verstanden, sondern ihre Realität gezeigt wird – nämlich in der Weberei, und kaum in Führungspositionen? Angemessen wäre es, wenn sich der Blick auf die Künste von Grund auf verändert. Denn die Biennale ist nicht nur in Venedig.17sondern auch in: Chengdu, Kairo, Singapur, Breslau, Ulaanbaatar, Porto Alegre, Ouagadougou, Prag, Casablanca, Bukarest, Shanghai, Moskau, Gwangju, Idanha-a-Nova, Havanna, Busan, Istanbul, Athen … Mehr anzeigen

Dieser Beitrag wurde zuerst in der Publikation „Eine Krise bekommen“ veröffentlicht. Studierende der Fakultät Visuelle Kommunikation an der Universität der Künste Berlin schreiben mit kritischem Blick über die Auswirkungen der Pandemie, ambivalente Identitäten und die politische Verantwortung der Kunsthochschule. Die vierzehn Beiträge entstanden im Jahr 2020 – einer Zeit, in der die Gefährdung verwundbarer Gruppen verdeutlicht wurde – aus dem Drang, unterrepräsentierte Auseinandersetzungen und studentische Perspektiven sichtbar zu machen. Sie fordern einen differenzierteren Austausch und Anerkennung marginalisierter Perspektiven in den Räumen der Kunsthochschule – anstelle von leeren Worten zu Vielfalt und Solidarität.
„Eine krise bekommen“ ist im Buchhandel und über den UdK Verlag erhältlich. Zum Preis von 5 Euro + ggf. Versandkosten kann die Publikation hier direkt bestellt werden:
einekrisebekommen@systemli.org
Link zur Online-Publikation:
https://opus4.kobv.de/opus4-udk/frontdoor/index/index/docId/1469
Anmeldungen zur Releaseparty/Lesung am 19.7.2021:
https://tripetto.app/run/2BJWQFMCZU
Referenzen
| 1 | Die Hochschule für Gestaltung Offenbach bietet die Studiengänge Kunst und Design an und genießt mit einem aufwendigen Aufnahmeverfahren und etwa 750 Studierenden einen hervorragenden Ruf. |
|---|---|
| 2 | Ahmed, Sara: Living a Feminist Life, Duke Univ. Press (2017) |
| 3 | Shor, Ira: Empowering Education: Critical Teaching for Social Change (1992) 23 |
| 4 | exitracismUdK ist ein offener Brief mit formulierten Forderungen an die Universität der Künste Berlin, und eine Antwort auf die „mangelnde Solidarität von Seiten der Lehrenden.“ https:// exitracismudk.wordpress.com/ (abgerufen am 11.03.21) |
| 5 | Ausschnitt eines Erfahrungsberichtes, welcher durch exitracismUdK in der UdK-Ausstellung KUNST RAUM STADT am 16-17.7.2020 gezeigt wurde. „2018 wurde ich für den Master an der UdK angenommen. Was die eigentliche Erfüllung eines lange erkämpften Traumes sein sollte, entpuppte sich als richtiger Horrortrip. […] Ich hatte das Gefühl, dass man von mir verlangte, meinen multiethnischen Background so zu präsentieren wie es für sie (die Lehrenden) am verdaulichsten ist: wenig kritisch und am liebsten exotisierend. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mich in diesem Umfeld einzufügen. Den Lehrenden fehlte es an emotionaler, pädagogischer, sowie (trans)kultureller Sensibilität – Queer student of color“ |
| 6 | bell hooks ist Literaturwissenschaftlerin, Professorin, Aktivistin und Autorin intersektionaler, anti-rassistischer und feministischer Bücher. |
| 7 | Kazeem-Kamiński, Belinda: Engaged Pedagogy: Antidiskriminatorisches Lehren und Lernen bei bell hooks (2016). |
| 8 | ebd. |
| 9 | Eine Positionierung in bestehenden Machtverhältnissen können Angaben zu unter anderem Geschlechtsidentitäten, sexuelle Identitäten, Behinderungen, Rassismuserfahrungen oder ökonomische Situationen sein. |
| 10 | Kazeem-Kamiński, Belinda: Engaged Pedagogy: Antidiskriminatorisches Lehren und Lernen bei bell hooks (2016) |
| 11 | Abdulla, Danah: Design Otherwise: Towards a locally-centric design education curricula in Jordan (2017) |
| 12 | Decolonising Design ist eine Forschungsgruppe, die analysiert, in welchen kolonialen Strukturen Gestaltung und Design agieren. (https://www.decolonisingdesign.com/) |
| 13 | Teaching Design ist eine Open Source Bibliografie mit dem Fokus auf Designvermittlung in der Bildung aus intersektional-feministischen, dekolonialen Perspektiven. (https://teaching design.net/) |
| 14 | Decentering Whiteness in Design History Resources ist eine Open Source Bibliografie, die von Designgeschichtsdozent*innen erstellt wurde als Reaktion auf die Forderungen der Studierenden, Perspektiven und Werke von Black, Indigenous, Latinx, Asian und anderen Designer*innen und Wissenschaftler*innen of Color in den Designkursen richtig zu repräsentieren. (https:// www.designhistorysociety.org/news/view/decentering-whiteness-in-design-history-resources) |
| 15 | Als mittlerweile zugelassene UdK-Studentin musste ich erleben, dass der Studienalltag von patriarchaler Hierarchie geprägt ist und von eurozentristischen Bewertungen abhängt, die umso persönlicher werden, da es an professioneller Distanz zu den Lehrenden fehlt (das verbreitete ‚per Du‘ dient oftmals lediglich dem Image der Universität). Meine Kursauswahl ist dementsprechend primär von den wenigen kritischen Lehrenden und kaum von den Inhalten abhängig. |
| 16 | Die Kunst- und Designschule Bauhaus war 1919-1933 aktiv, der Einfluss auf deutsche Kunsthochschulen bleibt weiterhin stark: In meinem Studium der Visuellen Kommunikationwurde ich in vielen Seminaren penetrant auf dessen Relevanz hingewiesen. |
| 17 | sondern auch in: Chengdu, Kairo, Singapur, Breslau, Ulaanbaatar, Porto Alegre, Ouagadougou, Prag, Casablanca, Bukarest, Shanghai, Moskau, Gwangju, Idanha-a-Nova, Havanna, Busan, Istanbul, Athen und vielen weiteren Orten. |
4rd of January 21
Dear Gloria Anzaldúa,
Ich setze mich an meinen Tisch, in einer kleinen Wohnung in kaltes dunkles Berlin. Als ich spreche, oder ich schreibe, ich sehe dich, im Licht, unter die Sonne, dein Gesicht, deine Haut.
Dein Brief – “Speaking In Tongues: A Letter To 3rd World Women Writers” – war mir 29 Jahre nicht bekannt und ich bin langsam beim Schreiben. Außerdem, du hattest Recht als du es gesagt hast, dass wir Hindernisse nicht überwinden werden, wir müssen durch das Gefahr gehen, hier sagt man “durchbeißen”, wenn ich die Sprache korrekt verstanden habe.
I’m not sure if I should be answering this letter as if you were directing it to me. But right now I don’t know to whom I should direct this. Should I write it to my mom and tell her about you? No, I prefer to do this in person, during a long talk. To my fellow creators I think is pointless since I much rather send them your beautiful letter instead. So I will write this one to you and I will call you by your first name and I will be very respectful.
This is gonna be written in my way of writing German, Portuguese, and English as my mind seems to be trapped in a confusion between this three. I also wanted to appropriate myself with your poetic way of intertwining both línguas maternas.
11th Jan 2021
Today was a grey snowy day. I walk over the bridge on my way to University and think about the words you wrote. Today I made the house very quiet, so I could only hear the old fridge screaming at me to write back to you. I thought it would make me more productive to sit in my yellow lighted desk, surrounded by my crayons, some candle light, shadowed by the plants, and just face the subject that is about to reveal from my writing.
The nakedness I see in your words makes me want to do the same, but I don’t know if I’m gonna like to see my demon of writing. Is not laziness you see, is resentimento. Writing might be one of those things that were denied to me as a brown girl growing up in São Paulo. In such a big place with people who have such big words, where is the space or even necessity to voice my thoughts? At least I used to think like that until I heard about you through Pêdra Costa, the first person to tell me I was an academic.
An academic in German University, a big combination of words that have very little to do with how I would see myself, but I am nobody to disagree with Pêdra Costa, so let me try and get along with it. Here I am, writing to you.

The first time I get in the room is a seminar, the discussion is about Foucault … Auf Deutsch! I am the only person from outside Europe in the class, the only third-world woman, can you imagine my face? As they discuss objectively all the violence I got to know by close and even experienced myself in Brasil and kalte Deutschland.
I think about the access to the education they had growing up. I split, that brown part is acknowledged, as I hadn’t yet reconciled with it. I get transported to my high school, where we were forbidden to get in the library due to the dangerous situation the room was left at, falling apart, piles of moldy books donated by the community. My spine starts to hurt, I can feel my bones shaking, my chest feels like is gonna jump on top of the table, I want to scream and run. I don’t understand myself, I can’t talk this language objectively, I can’t stand their privilege, the absence of others “like me” is violent. Or is it my privilege I can’t stand? Being part settler-colonizer as I am.
Either way, I have visions.
My mother overworking herself, her knees getting swallowed, 8 hours in front of the furniture store, in the loud and rainy city center, trying to catch the next client with her wide smile, her singing accent from Bahia.
Now she stays under the unforgiving sun, breathing warm wet air, selling apartments. She has her business now, dona do próprio nariz, still working a lot but on her own terms. At least I think so, for 6 years our relationship was reduced to a flat-screen, 15 cm x 6 cm wide.
She has nothing to do with simple, my mother is deep, she has the wisdom nobody in the academic world knows how to give prizes to. She knows how to survive a racist patriarchal society, gets her money, does business that would make any wall street gringo’s jaw drop, while singing Caetano, dancing in the kitchen, cooking her beans, and giving the most soul-warming look anybody can ever receive.
To be far from my family because of the system that had made them humans and us something in between beasts and invisible ghosts. I can say it was challenging to face them and to face “them” in me, both the white and the brown. But there is something important about being in the room.
Working as a cleaner for all those years had also made me a stranger to sitting at tables. I miss having all that body movement, I can feel my mind frying from sitting. I remember how it used to be in houses before I started to study, some wouldn’t even imagine to ask themselves, who I was, besides the exotic and servant imaginary I was not worthy of not even a look, or to have my name be remembered. Wake up, put on clothes, breath, put on some Racionais MC’s, jump on that train, go, clean clean clean, time management, discipline, get paid, go back. Next morning all over again. The romanticization of being working class sometimes was toxic, but I confess I still get the chills when I listen to “Deeper Love” from Aretha Franklin. It is almost dangerous how hustling after a while starts to make you proud of yourself. Some people were so evil with me I even started to trip and think I was paying for my ancestors’ sins.

A man even spat on me in front of my job once. But there were also the goody goods, the ones that would ask me my story, I would say I came to study, that I was at UdK, their eyes would go big, the treatment was different from that moment on. I used to feel sometimes like a savior, they would almost “like” me so much, I would get the creeps like they wanted to domesticate me. I was the perfect cleaner, the “educated”, “the-one-that-would-get-them” kind of person. There was a woman in Grünau that would try to get any way she could to book me, she would comment on how I dress, how I look, how I speak, how I study, ask “what made you come to do in Germany?”, she even had the nerve once to tell me I was too skinny, I laugh so hard at this kind of clients, in contrast, they made my life feel so absurdly beautiful in its simplicity.
They could have my time, they could have my physical effort, they could have my talk, my smile, but they would never get my mind, which was jumping around, thinking about 2pac, “It’s just me against the world”, thinking about boys, thinking about drawing, crazy ideas for animations, I created complete long movies in my head, performances, I would think about politics, I loved to look at the shelves, pick their brains, some had some really good books I would take pictures. At every swipe I was rewriting myself, myself for myself, it would happen in my mind, nobody could use it, nobody could judge it, I would imagine myself outside my body. But they would try. The Kalk in the bathrooms, a lap for every specific function, the product smells, I love the one that was Lavanda, the lemon one where disgusting though, the pink for the toilet, the blue for the living room, the yellow for the kitchen.
I also found humanity, the honest and kind hearted people, the ones that helped me analyze my portfolio to get to University, the old lady who invited me to lunch, the one who spoke Portuguese, would give me books, I have an actual feeling of love for them.
The thick skin as you advised is starting to build up. New acknowledgments are appearing from the discussions little by little. To not see everything through the “good or bad” lenses. Violent processes have no other way but violent ways to be dismantled. But affection is a valid way too, afinal “O sorriso é a única língua que todos entendem”. The subject must be geographically positioned and self-criticism is a very important tool.
There is still a lot of work to do, there is so much to grow, to appropriate, to learn. That’s why this letter is still so confused. I want to complement this with drawings inspired by your words.
But there is more. About writing.
Between you and me. Writing might be that one thing that fell down the whole on me, the whole of frustration. That thing that has not been seeing the light of the day, so it is kind of … moldy. Assombrosa. I start to ask myself why when I write I talk so much about myself, I feel selfish. Lacking objectivity. Until I read “Stop the chatter inside their heads”. This gave me the understanding to see that, there is a force in this world trying to tell us who we are and that I have let the image of myself eat me up from inside out way too long. That pain on my spine I talked about, has a lot to do with this chatter, my silence.
So as much as it makes me uncomfortable I have to talk for myself, I can’t talk for all of us, mix raced, traped in between, third world women, migrants, working class. But I can rewrite what being all of that means to me, instead of letting them do the talk.
To me, it is to walk on the gray streets of dreckige Berlin listening to Milton Nascimento and still feel the warm breeze of the ocean on my skin. To get in communion with other “third world” people, complain laughing, while we make up dreams of a comfortable life working with whatever we want. Is to love to work, por a mão na massa, to make my money, to surprise myself with how far I can get without stepping on others, which, knowledge has led me to believe that this is actually an everyday failure.
Is to look back at my ancestors, to be connected to the spirit of my creole grandpa and my indigenous grandma putting me back on track, to keep trying to find ways. There is nothing romantic about that but somehow I still manage to write as if it was. Inferno!
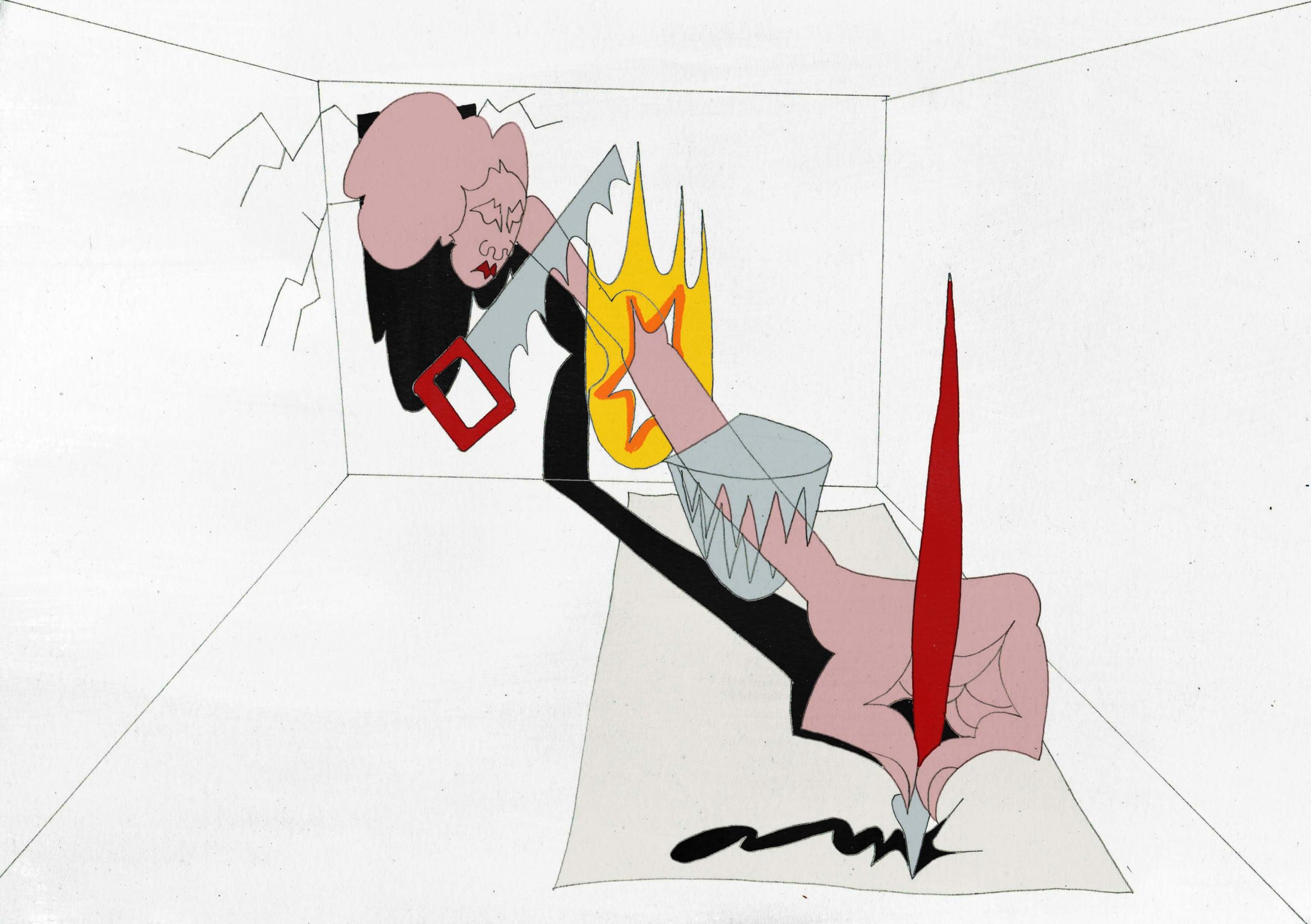
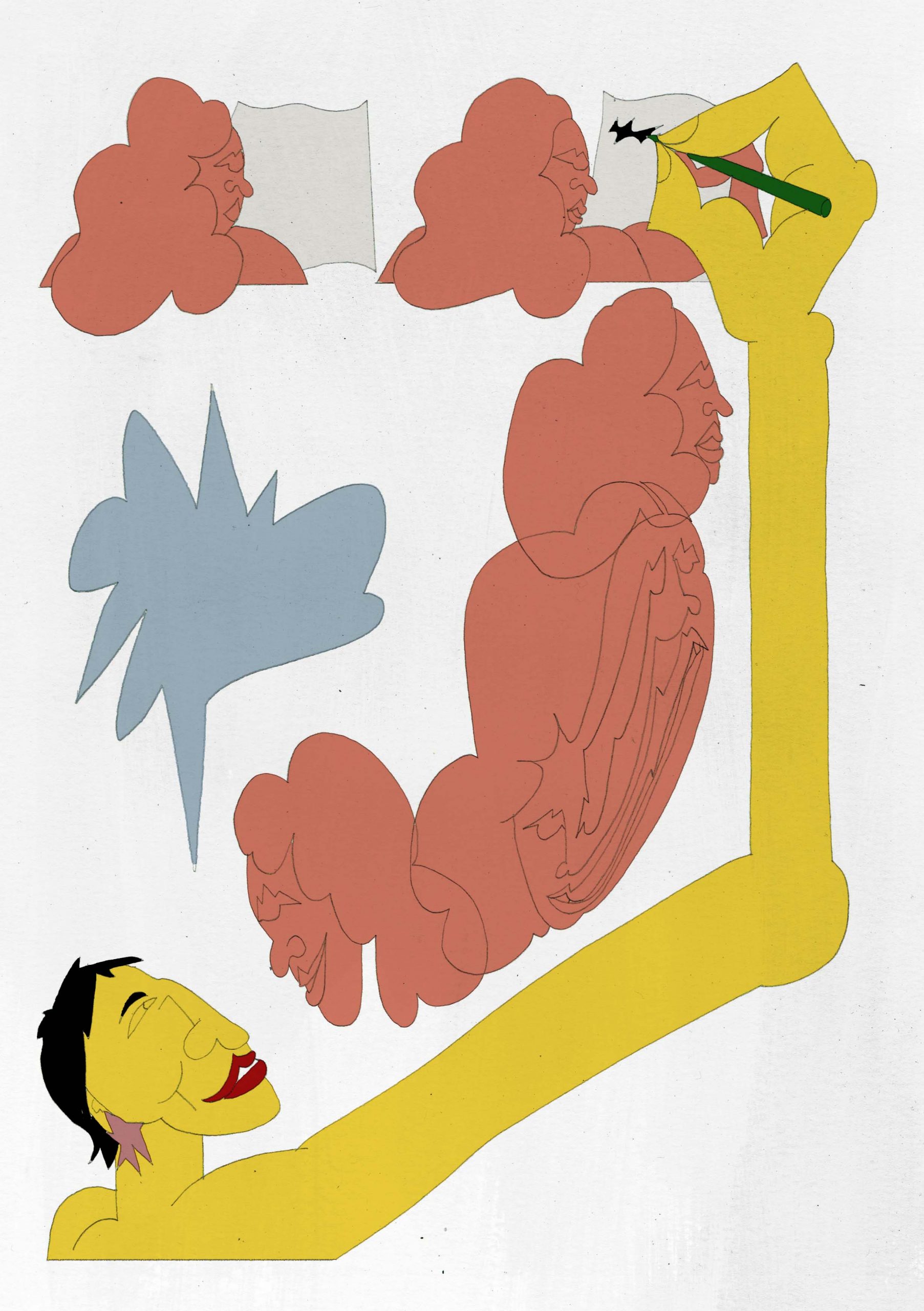
25 de Janeiro 2021
I see your words as a kind of magic. There are symbols and metaphors you use to describe the feeling. Like that Tiger on the shoulder. Your hand coming from miles away and grabbing the hands of other writers as you clench the pen in togetherness. To write cooking a dinner. To empty oneself.
This is the way I feel when I draw. This is the way I relate to reality and it has its language. Sometimes it gets stuck in places where only the water that passes over bridges can reach to make it flow. The water with your words. I keep digging it up. The wind you blew yesterday is feeding the fire in our tongues today.
With love,
Thaís
This letter is an answer to the text “Speaking In Tongues: A Letter To 3rd World Women Writers” written by Gloria Anzaldúa, and published in the book “This Bridge Called My Back” (1981) edited by Cherrie Moraga and Gloria Anzaldúa. The letter was written during the Seminar “Seeing ourselves clearly” with Pary Beata El-Qalqili during the Winter Semester 2020/21 at the Berlin University of the Arts.

Katharina Oguntoye ist eine afrodeutsche Schriftstellerin, Historikerin, Aktivistin und Dichterin. Sie gründete den gemeinnützigen interkulturellen Verein Joliba in Deutschland und spielte eine wichtige Rolle in den Anfängen der afrodeutschen Bewegung. Prof. Mathilde ter Heijne hat sich mit ihr getroffen um über das Buch Farbe bekennen zu sprechen, welches 1986 von Katharina Oguntoye mit May Ayim und Dagmar Schultz im Orlanda Verlag herausgegeben wurde. Die Sammlung ist eine Zusammenstellung von Texten, Zeugnissen und anderen Sekundärquellen und lässt die Geschichten Schwarzer deutscher Frauen, die in Deutschland inmitten von Rassismus, Sexismus und anderen institutionellen Zwängen leben, lebendig werden. Das Buch greift Themen und Motive auf, die in Deutschland von den frühesten kolonialen Interaktionen zwischen Deutschland und der Schwarzen „Andersartigkeit“ bis hin zu den gelebten Erfahrungen Schwarzer deutscher Frauen in den 1980er Jahren vorherrschen.
Der Ausgangspunkt des Gesprächs war Looking Back 1930 I 2020: Building on Fragmented Legacies, ein Performance- und Diskussionsabend mit Karina Griffith, Sandrine Micossé-Aikins, Katharina Oguntoye, Abenaa Adomako und Saraya Gomis am 24.09.2020 im HAU Berlin. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Programms Radical Mutation – On the Ruins of Rising Suns statt, kuratiert von Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, Saskia Köbschall und Tmnit Zere. Das Programm verband historische Kämpfe für Gleichberechtigung, Antirassismus und Repräsentation in der Kultur und aktuelle Bemühungen um radikale Veränderungen mit Berlin als Startpunkt. Der Titel bezog sich auf eines der ersten überlieferten schwarzen Theaterstücke (Sonnenaufgang im Morgenland, 1930), welches die Repräsentation von Schwarzen Menschen in kulturellen Produktionen der Weimarer Republik in Frage stellte.
Ableismus ist die Diskriminierung und das soziale Vorurteil gegenüber Menschen mit bestimmten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Bedürfnissen. In der Regel handelt es sich dabei um eine Abwertung der physischen und psychischen Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, die auf einer vermeintlichen biologischen (körperlichen und/oder geistigen) Norm dessen beruht, was ein nichtbehinderter, neurotypischer Mensch sein sollte. Ableismus kann sich mit anderen Formen der Unterdrückung wie Rassismus und Sexismus überschneiden.
Adultismus ist die im Alltag und im Recht anzutreffende Diskriminierung, die auf ungleichen Machtverhältnissen zwischen Erwachsenen einerseits und Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen andererseits beruht.
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), das seit 2006 in Kraft ist, ist das einheitliche zentrale Regelwerk in Deutschland zur Umsetzung von vier europäischen Antidiskriminierungsrichtlinien. Erstmals wurde in Deutschland ein Gesetz geschaffen, das den Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Rassifizierung, ethnischer Herkunft, Geschlechtsidentität, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, des Alters oder der sexuellen Orientierung umfassend regelt.
Antisemitismus ist eine Weltanschauung, die auf Hass/Feindseligkeit gegenüber jüdischen Menschen als religiöser oder rassifizierter Gruppe, jüdischen Einrichtungen oder allem, was als jüdisch wahrgenommen wird, beruht oder diese diskriminiert. Antisemitismus kann im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Kulturen variieren und sich in verschiedenen historischen Momenten intensivieren.
Audismus bezeichnet die Diskriminierung von Tauben, die auf einer höheren Wertschätzung des Hörens und Sprechens sowie der Abwertung von Tauben als „defekt“ beruht. Dies führt zur Marginalisierung der Gehörlosenkultur und der Gebärdensprache. (Quelle: Diversity Arts Culture)
Barrierefreiheit bezeichnet das Ausmaß, in dem ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Umgebung für möglichst viele Menschen zugänglich ist und von ihnen genutzt werden kann. Inklusive Barrierefreiheit bewertet daher die Bedürfnisse und Wünsche aller möglichen Menschen – einschließlich derjenigen, die neurodivergent sind oder unterschiedliche Fähigkeiten haben – und bezieht diese in Design und Funktion mit ein. Änderungen, die Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten die gleiche Chance und Teilnahme ermöglichen, werden oft als behindertengerechte Anpassungen bezeichnet.
Belästigung ist ein unerwünschtes und nicht einvernehmliches Verhalten, das die Würde einer anderen Person verletzt. Belästigung kann oft ein einschüchterndes, feindseliges, demütigendes oder kränkendes soziales Klima erzeugen und kann auf der sexuellen Orientierung, der Religion, der nationalen Herkunft, einer Behinderung, dem Alter, der Rassifizierung, dem Geschlecht usw. einer Person beruhen. Belästigungen können verschiedene Formen annehmen, darunter verbale, körperliche und/oder sexualisierte.
Das binäre Geschlecht ist die Einteilung der Geschlechter in zwei unterschiedliche und entgegengesetzte Kategorien: Mann/männlich und Frau/feminin. Dieses Glaubenssystem geht davon aus, dass das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht mit den traditionellen sozialen Konstruktionen von männlicher und weiblicher Identität, Ausdruck und Sexualität übereinstimmt. Eine Zuweisung außerhalb des binären Geschlechts wird in der Regel als Abweichung von der Norm betrachtet.
Das Konzept des biologischen Geschlechts bezieht sich auf den biologischen Status einer Person, welcher meist bei der Geburt zugewiesen wird – in der Regel aufgrund der äußeren Anatomie. Das biologische Geschlecht wird in der Regel als männlich, weiblich oder intersexuell kategorisiert.
Cis-Geschlechtlichkeit, oder einfach cis, bezieht sich auf Menschen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Cis kommt von der lateinischen Vorsilbe, die „auf dieser Seite von“ bedeutet.
as Konzept nach Birgit Rommelspacher geht davon aus, dass es ein System von Hierarchien, Herrschaft und Macht gibt, indem die verschiedenen rassistischen, sexistischen, klassistischen und weiteren Herrschaftsformen sich ineinander verflechten. In dieser Verflechtung hat jeweils eine dominante Gruppe die Macht, welche gesellschaftlich immer wieder ausgehandelt wird. In einer bestehenden Gesellschaft erlangt die dominante Gruppe ihre Rolle dadurch, dass sie als zur Mehrheit der Bevölkerung gehörend wahrgenommen wird und in den gesellschaftlichen Institutionen eine bedeutende Präsenz hat.
Der gefängnisindustrielle Komplex (PIC) ist ein Begriff, der die komplexen und miteinander verknüpften Abhängigkeiten zwischen einer Regierung und den verschiedenen Unternehmen und Institutionen beschreibt, die von den Praktiken der Freiheitsentziehung profitieren (z. B. Gefängnisse, Haftanstalten, Abschiebeeinrichtungen und psychiatrische Kliniken). In Anlehnung an den Begriff „militärisch-industrieller Komplex” plädiert der PIC für eine umfassendere Analyse der Art und Weise, wie die Freiheitsberaubung in einer Gesellschaft eingesetzt wird, und nennt alle Interessengruppen, die finanzielle Gewinne über Strategien der Vermeidung der Inhaftierung von Menschen stellen.
Genderexpansiv ist ein Adjektiv, das eine Person mit einer flexibleren und fließenderen Geschlechtsidentität beschreiben kann, als mit der typischen binären Geschlechtszugehörigkeit assoziiert werden könnte.
Geschlecht wird oft als soziales Konstrukt von Normen, Verhaltensweisen und Rollen definiert, die sich von Gesellschaft zu Gesellschaft und im Laufe der Zeit verändern. Es wird oft als männlich, weiblich oder nicht-binär kategorisiert.
Die Geschlechtsangleichung ist ein Prozess, den eine Person durchlaufen kann, um sich selbst und/oder ihren Körper in Einklang mit ihrer Geschlechtsidentität zu bringen. Dieser Prozess ist weder ein einzelner Schritt noch hat er ein bestimmtes Ende. Vielmehr kann er eine, keine oder alle der folgenden Maßnahmen umfassen: Information der Familie und des sozialen Umfelds, Änderung des Namens und der Pronomen, Aktualisierung rechtlicher Dokumente, medizinische Maßnahmen wie Hormontherapie oder chirurgische Eingriffe, die oft als geschlechtsangleichende Operation bezeichnet werden.
Der Ausdruck des Geschlechts ist die Art und Weise, wie eine Person ihr Geschlecht nach außen hin verkörpert, was in der Regel durch Kleidung, Stimme, Verhalten und andere wahrgenommene Merkmale signalisiert wird. Die Gesellschaft stuft diese Merkmale und Leistungen als männlich oder weiblich ein, obwohl das, was als männlich oder weiblich gilt, im Laufe der Zeit und zwischen den Kulturen variiert.
Geschlechtsdysphorie ist eine psychische Belastung, die sich aus der Inkongruenz zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht und der eigenen Geschlechtsidentität ergibt. Menschen aller Geschlechter können Dysphorie in unterschiedlicher Intensität oder auch überhaupt nicht erleben.
Die Geschlechtsidentität ist das innere Selbstverständnis einer Person in Bezug auf ihr Geschlecht. Im Gegensatz zum Geschlechtsausdruck ist die Geschlechtsidentität für andere nicht äußerlich sichtbar.
Heteronormativität ist das Konzept, dass Heterosexualität – romantische und/oder sexuelle Anziehung zwischen Menschen des „anderen“ Geschlechts – die normative oder einzig akzeptierte sexuelle Orientierung in einer Gesellschaft ist. Heteronormativität geht vom binären Geschlechtsmodell aus und beinhaltet daher den Glauben an eine Übereinstimmung zwischen Sexualität, Geschlechtsidentität, Geschlechterrollen und biologischem Geschlecht. Als vorherrschende soziale Norm führt die Heteronormativität zu Diskriminierung und Unterdrückung derjenigen, die sich nicht als heterosexuell identifizieren.
Bei der Hormontherapie, auch geschlechtsangleichende Hormontherapie (GAHT) oder Hormonersatztherapie (HRT) genannt, werden Geschlechtshormone oder andere hormonelle Medikamente verabreicht. Diese Hormonveränderungen können körperliche Veränderungen auslösen, die als sekundäre Geschlechtsmerkmale bezeichnet werden und dazu beitragen können, den Körper besser auf die Geschlechtsidentität einer Person anzupassen.
Institutionelle Diskriminierung bezieht sich auf vorurteilsbehaftete organisatorische Maßnahmen und Praktiken innerhalb von Institutionen – wie Universitäten, Unternehmen usw. –, die dazu führen, dass eine marginalisierte Person oder Personengruppe ungleich behandelt wird und ungleiche Rechte hat.
Inter* oder Intergeschlechtlichkeit ist ein Oberbegriff, der Menschen beschreiben kann, die Unterschiede in der reproduktiven Anatomie, bei den Chromosomen oder den Hormonen aufweisen, die nicht den typischen Definitionen von männlich und weiblich entsprechen. Das Sternchen (*) unterstreicht die Vielfalt der intersexuellen Realitäten und Körperlichkeiten.
Intergenerationales Trauma bezieht sich auf das Trauma, das von einer traumaüberlebenden Person an deren Nachkommen weitergegeben wird. Aufgrund von gewalttätigen und lebensbedrohlichen Ereignissen wie Kriegen, ethnischen Säuberungen, politischen Konflikten, Umweltkatastrophen usw., die von früheren Generationen erlebt wurden, können die Nachkommen negative emotionale, körperliche und psychologische Auswirkungen erfahren. Da die ursprünglichen Ursachen von Traumata durch Formen der Diskriminierung wie Rassifizierung und Geschlecht bedingt sind, treten intergenerationale Traumata auch entlang intersektionaler Achsen der Unterdrückung auf. Schwarze Gemeinschaften haben zum Beispiel das intergenerationale Trauma der Versklavung ans Licht gebracht. Intergenerationales Trauma wird manchmal auch als historisches Trauma, multi- oder transgenerationales Trauma oder sekundäre Traumatisierung bezeichnet.
Intersektionalität benennt die Verflechtung von Unterdrückungssystemen und sozialen Kategorisierungen wie Rassifizierung, Geschlecht, Sexualität, Religion, Migrationsgeschichte, Klasse und mehr. Intersektionalität betont, dass die einzelnen Formen der Diskriminierung nicht unabhängig voneinander existieren und auch nicht unabhängig voneinander betrachtet und bekämpft werden können. Vielmehr sollten bei der Bekämpfung von Unterdrückung die kumulativen und miteinander verknüpften Achsen der verschiedenen Formen von Diskriminierung berücksichtigt werden.
Islamophobie ist eine Weltanschauung, die auf Hass/Feindseligkeit gegenüber muslimischen Menschen als religiöser oder rassifizierter Gruppe, muslimischen Einrichtungen oder allem, was als muslimisch wahrgenommen wird, beruht oder diese diskriminiert. Islamophobie kann im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Kulturen variieren und sich in verschiedenen historischen Momenten intensivieren.
Klassismus ist ein Begriff, der die Diskriminierung beschreibt, die auf der Überzeugung beruht, dass der soziale oder wirtschaftliche Status einer Person ihren Wert in der Gesellschaft bestimmt. Klassismus als eine Form der Diskriminierung und Stigmatisierung basiert auf tatsächlichen oder angenommenen finanziellen Mitteln, dem Bildungsstatus und der sozialen Integration. In der Hierarchie „unterlegene“ gesellschaftliche Klassen werden problematisiert und stereotypisiert und erhalten oft ungleichen Zugang und Rechte innerhalb der Gesellschaft.
Kolonialismus ist die Kontrolle und Dominanz einer herrschenden Macht über ein untergeordnetes Gebiet oder Volk. Bei der Unterwerfung eines anderen Volkes und Landes beinhaltet der Kolonialismus die gewaltsame Eroberung der Bevölkerung, die oft mit der Massenvertreibung von Menschen und der systematischen Ausbeutung von Ressourcen einhergeht. Abgesehen von den materiellen Folgen zwingt der Kolonialismus dem unterworfenen Volk auch die Sprache und die kulturellen Werte der herrschenden Macht auf, was kulturelle, psychologische und generationenübergreifende Traumata zur Folge hat.
Kulturalistisch argumentierter Rassismus richtet sich gegen Menschen aufgrund ihres mutmaßlichen kulturellen oder religiösen Hintergrunds. Diese Form der Diskriminierung kann unabhängig davon auftreten, ob sie tatsächlich eine Kultur oder Religion ausüben und wie religiös sie sind (z. B. antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus).
Kulturelle Aneignung ist der Akt der Übernahme von Aspekten einer marginalisierten Kultur durch eine Person oder eine Institution, die dieser Kultur nicht angehört, ohne umfassendes Verständnis des Kontexts und oft ohne Respekt für die Bedeutung des Originals. Kulturelle Aneignung reproduziert Schaden, wenn sie negative kulturelle oder rassistische Stereotypen fördert. Kulturelle Aneignung kann oft die Machtdynamik innerhalb einer Gesellschaft offenbaren: So wird beispielsweise eine weiße Person, die die traditionelle Kleidung einer marginalisierten Kultur trägt, als modisch gelobt, während eine rassifizierte Person von der dominanten Gruppe isoliert und als fremd bezeichnet werden könnte.
Marginalisierung beschreibt jeglichen Prozess der Verdrängung von Minderheiten an den Rand der Gesellschaft. Marginalisierten Gruppen wird in der Regel unterstellt, dass sie nicht der normorientierten Mehrheit der Gesellschaft entsprechen und sind in ihren Möglichkeiten, sich frei zu verhalten, gleichen materiellen Zugang zu haben, öffentliche Sicherheit zu genießen usw., stark eingeschränkt.
Mikroaggression bezeichnet einzelne Kommentare oder Handlungen, die unbewusst oder bewusst Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Mitgliedern von Randgruppen zum Ausdruck bringen. Als kleine, häufige und kumulative Vorkommnisse können Mikroaggressionen aus Beleidigungen, Stereotypen, Abwertung und/oder Ausgrenzung bestehen. Mikroaggressionen wirken sich oft negativ auf die Person aus, die sie erleidet, und beeinträchtigen ihre psychische und physische Gesundheit und ihr Wohlbefinden.
Misogynie ist ein Begriff für sexistische Unterdrückung und Verachtung von Frauen, der dazu dient, Frauen in einem niedrigeren sozialen Status als Männer zu halten und so patriarchalische soziale Rollen aufrechtzuerhalten. Misogynie kann eine Haltung von Einzelpersonen und ein weit verbreitetes kulturelles System bezeichnen, das häufig alles abwertet, was als weiblich wahrgenommen wird. Frauenfeindlichkeit kann sich mit anderen Formen der Unterdrückung und des Hasses überschneiden, z. B. mit Homophobie, Trans*-Misogynie und Rassismus.
Neurodiversität ist ein Begriff, der die einzigartige Funktionsweise der Gehirnstrukturen eines jeden Menschen beschreibt. Die Grundannahme, welche Art von Gehirnfunktion in einer normorientierten Mehrheitsgesellschaft gesund und akzeptabel ist, wird als neurotypisch bezeichnet.
Nonbinär ist ein Begriff, der von Personen genutzt werden kann, die sich selbst oder ihr Geschlecht nicht in die binären Kategorien von Mann oder Frau einordnen. Es gibt eine Reihe von Begriffen für diese Erfahrungen, wobei nonbinary und genderqueer häufig verwendet werden.
Das Patriarchat ist ein soziales System, in dem cis-geschlechtliche Männer sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich eine privilegierte Stellung einnehmen. In der feministischen Theorie kann der Begriff verwendet werden, um das Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern zu beschreiben, das die männliche Dominanz begünstigt, sowie die Ideologie der männlichen Überlegenheit, die die Unterdrückung von Frauen und allen nicht-normativen Geschlechtern rechtfertigt und durchsetzt.
Pronomen oder persönliche Geschlechtspronomen (PGP) sind die Pronomen, die eine Person verwendet, um sich selbst zu bezeichnen, und die andere verwenden sollen, wenn sie sich auf sie beziehen. Die Liste der Pronomen entwickelt sich ständig weiter. Eine Person kann mehrere bevorzugte Pronomen haben oder auch gar keine. Die Absicht, die Pronomen einer Person zu erfragen und korrekt zu verwenden, besteht darin, die negativen gesellschaftlichen Auswirkungen für diejenigen zu verringern, deren persönliche Pronomen nicht mit der Geschlechtsidentität übereinstimmen, die von einer cis-normativen Gesellschaft angenommen wird. Die Verwendung geschlechtsneutraler Formulierungen und Begriffe sind ebenfalls inkludierende Schritte, die sich dem binären Geschlechtermodell und der Cis-Normativität widersetzen.
Rassismus ist der Prozess, durch den Systeme, politische Maßnahmen, Aktionen und Einstellungen ungleiche Chancen und Auswirkungen für Menschen aufgrund von Rassifizierung und rassistischen Zuschreibungen schaffen. Rassismus geht über individuelle oder institutionelle Vorurteile hinaus und tritt auf, wenn diese Diskriminierung mit der Macht einhergeht, die Rechte von Menschen und/oder Gruppen einzuschränken oder zu unterdrücken. Rassismus kann im Laufe der Zeit und in unterschiedlichen Kulturen variieren und sich in verschiedenen historischen Momenten intensivieren.
Sex-Gender-Differenz bezeichnet die Unterscheidung zwischen dem Konzept des „biologischen Geschlechts“ als biologischer Tatsache und dem Konzept des „sozialen Geschlechts“ als Produkt kultureller und sozialer Prozesse, wie z. B. sozial konstruierte Rollen, Verhaltensweisen, Ausdrucksformen und geschlechtsspezifische Identitäten.
Sexismus ist der Prozess, durch den Systeme, Politiken, Handlungen und Einstellungen ungleiche Chancen und Auswirkungen für Menschen auf der Grundlage ihres zugeschriebenen oder vermeintlichen Geschlechts schaffen und beschreibt die Ideologie, die diesen Phänomenen zugrunde liegt. Der Begriff wird meist verwendet, um die Machtverhältnisse zwischen dominanten und marginalisierten Geschlechtern in cisheteronormativen patriarchalen Gesellschaften zu benennen.
Sexuelle Orientierung ist der Begriff, der beschreibt, zu welchem Geschlecht sich eine Person emotional, körperlich, romantisch und/oder sexuell hingezogen fühlt.
Die soziale Herkunft beschreibt die soziokulturellen Werte und Normen, in die jemand hineingeboren wird, einschließlich Faktoren wie Umfeld, Klasse, Kaste, Bildungsbiografie und mehr. Die Werte, die mit der sozialen Herkunft einhergehen, sind konstruiert, haben aber oft materielle Auswirkungen, die bestimmte Gruppen und Menschen privilegieren oder benachteiligen. Wer beispielsweise in einem westlichen Land lebt, generationenübergreifenden Reichtum geerbt hat und über eine durchweg gute Ausbildung verfügt, hat als Erwachsener bessere Chancen auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Die soziale Herkunft muss also berücksichtigt werden und nicht die inhärente Eignung für einen Job.
Eine soziale Norm ist ein gemeinsamer Glaube an den Standard für akzeptables Verhalten von Gruppen, der sowohl informell als auch in der Politik oder im Gesetz verankert ist. Soziale Normen unterscheiden sich im Laufe der Zeit und zwischen verschiedenen Kulturen und Gesellschaften.
Der sozioökonomische Status, der in der Regel als niedrig, mittel oder hoch eingeordnet wird, beschreibt Menschen auf der Grundlage ihrer Ausbildung, ihres Einkommens und der Art ihrer Tätigkeit. Die Werte und Normen, die den einzelnen sozioökonomischen Klassen zugeordnet werden, sind sozial konstruiert, haben aber materielle Auswirkungen.
Strukturelle Diskriminierung bezieht sich auf Verhaltensmuster, Strategien und Einstellungen, die auf der Makroebene der Gesellschaft zu finden sind. Diese Diskriminierung sozialer Gruppen beruht auf der Natur der Gesellschaftsstruktur als Ganzes. Strukturelle Diskriminierung unterscheidet sich von individuellen Formen der Diskriminierung (z. B. eine einzelne rassistische Bemerkung, die eine Mikroaggression darstellt), obwohl sie oft den kontextuellen Rahmen für das Verständnis der Gründe für diese individuellen Fälle liefert.
Taub (in Großschreibung) ist eine positive Selbstbezeichnung für nicht hörende Menschen, unabhängig davon, ob sie taub, resthörig oder schwerhörig sind. Sie zeigt, dass Taubheit nicht als Defizit gilt. Einige Mitglieder der Tauben-Community bevorzugen „Taub“, weil es im Gegensatz zu „gehörlos“ nicht schon einen Mangel impliziert. (Quelle: Diversity Arts Culture)
Tokenismus ist eine nur oberflächliche oder symbolische Geste, die Angehörige von Minderheiten einbindet, ohne die strukturelle Diskriminierung der Marginalisierung wesentlich zu verändern oder zu beseitigen. Der Tokenismus ist eine Strategie, die den Anschein von Inklusion erwecken und von Diskriminierungsvorwürfen ablenken soll, indem eine einzelne Person als Vertreter einer Minderheit eingesetzt wird.
Weiße Vorherrschaft bezeichnet die Überzeugungen und Praktiken, die Weiße als eine von Natur aus überlegene soziale Gruppe privilegieren, die auf dem Ausschluss und der Benachteiligung anderer rassifizierter und ethnischer Gruppen beruht. Sie kann sich auf die miteinander verknüpften sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systeme beziehen, die es Weißen ermöglichen, sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene strukturelle Vorteile gegenüber rassifizierten Gruppen zu genießen. Der Begriff kann sich auch auf die zugrundeliegende politische Ideologie beziehen, die vielfältige Formen der Vorherrschaft von Weißen und nicht-weißen Anhängern erzwingt und aufrechterhält, von der Rechtfertigung des europäischen Kolonialismus bis hin zu den heutigen Neofaschismen.
Weißsein ist ein gesellschaftlich und politisch konstruiertes Verhalten, das eine Ideologie, Kultur, Geschichte und Wirtschaft aufrechterhält, die zu einer ungleichen Verteilung von Macht und Privilegien zugunsten derjenigen führt, die gesellschaftlich als weiß gelten. Die materiellen Vorteile des Weißseins werden auf Kosten Schwarzer, indigener und Menschen of Color erzielt, denen systematisch der gleiche Zugang zu diesen materiellen Vorteilen verwehrt wird. Auf diesem Blog wird weiß oftmals kursiv geschrieben, um es als politische Kategorie zu kennzeichnen und die Privilegien des Weißseins zu betonen, die oft nicht als solche benannt, sondern als unsichtbare Norm vorausgesetzt werden.
Xenophobie bezeichnet die Feindseligkeit gegenüber Gruppen oder Personen, die aufgrund ihrer Kultur als „fremd“ wahrgenommen werden. Fremdenfeindliche Haltungen sind oft mit einer feindseligen Aufnahme von Einwanderern oder Flüchtlingen verbunden, die in Gesellschaften und Gemeinschaften ankommen, die nicht ihre Heimat sind. Fremdenfeindliche Diskriminierung kann zu Hindernissen beim gleichberechtigten Zugang zu sozioökonomischen Chancen sowie zu ethnischen, rassistischen oder religiösen Vorurteilen führen.
Abolition ist ein Begriff, der das offizielle Ende eines Systems, einer Praxis oder einer Institution bezeichnet. Der Begriff hat seine Wurzeln in den Bewegungen zur Abschaffung der Sklaverei im 19. Jahrhundert und wird heute oft verwendet, um die Praxis der Polizei und des Militärs und/oder die miteinander verbundenen Gefängnisse, Geflüchtetenlager, Haftanstalten usw. zu beenden. Weitere Informationen finden Sie in der Definition des gefängnisindustrielle Komplexes).
Accountability oder auch Rechenschaftspflicht ist die Verpflichtung und die Bereitschaft, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Im Zusammenhang mit sozialer Gerechtigkeit bezieht sich die Rechenschaftspflicht auf die Art und Weise, in der Einzelpersonen und Gemeinschaften sich selbst an ihre Grundsätze und Ziele halten und die Gruppen anerkennen, denen gegenüber sie verantwortlich sind. Rechenschaftspflicht erfordert oft einen transparenten Prozess und ein kontinuierliches Selbst- und Kollektivbewusstsein.
Ageism, auch Altersdiskriminierung genannt, ist eine Diskriminierung oder ein Vorurteil aufgrund des Alters einer Person, z. B. wenn Fähigkeiten und Fertigkeiten aufgrund des höheren oder niedrigeren Alters einer Person in Frage gestellt und bewertet werden.
Agender ist ein Adjektiv, das von Personen genutzt werden kann, die sich mit keinem bestimmten Geschlecht identifizieren.
BIPoC steht für Black, Indigenous und People of Color. Dieser aus den USA stammende Begriff ist eine Selbstbezeichnung, die darauf abzielt, Menschen und Gruppen zu vereinen, die von Rassismus betroffen sind. Die Selbstbezeichnung rückt die spezifischen Erfahrungen Schwarzer, indigener und anders rassifizierter Gruppen in den Mittelpunkt, welche stark von systematischer rassistischer Ungleichbehandlung, deren Wurzeln in der Geschichte der Versklavung und des Kolonialismus liegen, betroffen sind.
Colorism ist ein Begriff, der die Vorurteile oder Diskriminierung beschreibt, welche rassifizierte Menschen mit hellerer Hautfarbe bevorzugt, während solche mit dunklerer Hautfarbe benachteiligt werden. Er wird vor allem verwendet, um die nuancierte Diskriminierung innerhalb einer rassifizierten oder ethnischen Gruppe zu beschreiben.
Die Critical Diversity Policy der UdK ist ein Dokument, welches die Vorstellung hervorheben und durchsetzen soll, dass Unterschiede in Werten, Einstellungen, kulturellen Perspektiven, Überzeugungen, ethnischen Hintergründen, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Fähigkeiten, Wissen und Lebenserfahrungen jeder*jedes Einzelnen in jeder Gruppe von Menschen innerhalb der Universität berücksichtigt und überwunden werden sollten.
Deadnaming ist der Akt, für eine trans*, nicht-binäre oder genderexpansive Person mit ihren Geburtsnamen oder einen falschen Namen zu nutzen, wenn diese ihren Namen als Teil ihres Geschlechtsausdrucks geändert hat. Es ist niemals in Ordnung oder notwendig, den Deadname einer Person zu verwenden, wenn sie ihren Namen geändert hat, auch nicht bei der Beschreibung von Ereignissen in der Vergangenheit. Wenn Du eine Person mit ihrem Deadname anredest, übernimm Verantwortung, indem Du dich entschuldigst und verpflichtest, dies in Zukunft nicht mehr zu tun. Erkundige Dich nach dem aktuellen Namen der Person und bemüh Dich, ihn konsequent zu verwenden.
Dieser soziologische Begriff konzentriert sich auf die Art und Weise, wie Menschen Geschlecht wahrnehmen, (re-)produzieren und im täglichen Leben als relevant erachten. Im Gegensatz zur Annahme, dass Geschlecht eine angeborene Eigenschaft ist, unterstreicht das Konzept des “doing gender”, dass Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, das die tägliche menschliche Interaktion prägt.
Misogynoir ist ein von der Schwarzen Feministin Moya Bailey 2010 geprägter Begriff, der die geschlechtsspezifische und rassistische Unterdrückung beschreibt, mit der Schwarze Cis- und Transgender-Frauen konfrontiert sind (letztere wird manchmal auch durch den Begriff Trans*-Misogynoir charakterisiert). Ausgehend von einer intersektionalen Sichtweise untersucht das Konzept, wie sich anti-Schwarzer Rassismus und Frauenfeindlichkeit zu einer besonderen Form der Unterdrückung und Diskriminierung verbinden.
Queer ist ein Oberbegriff für Menschen, die nicht heterosexuell oder cisgender sind. Er wird für ein breites Spektrum an nicht-normativen sexuellen und/oder geschlechtlichen Identitäten und Politiken verwendet.
Safer Spaces sollen Orte sein, an denen marginalisierte Gemeinschaften zusammenkommen und gemeinsame Erfahrungen austauschen können, frei von Voreingenommenheit, Konflikten oder Verletzungen, die von Mitgliedern einer dominanten Gruppe verursacht werden. In Anerkennung der Tatsache, dass es unter den gegenwärtigen Systemen unserer Gesellschaft keinen vollkommen sicheren Raum für marginalisierte Menschen gibt, verweist der Begriff „safer“ auf das Ziel einer vorübergehenden Entlastung sowie auf die Anerkennung der Tatsache, dass Verletzungen auch innerhalb marginalisierter Gemeinschaften reproduziert werden können. Beispiele für sichere Räume, die in Organisationen und Institutionen geschaffen wurden, sind Queer-only Räume und/oder Räume nur für Schwarze, Indigene und People of Color.
Social Justice ist eine Form des Aktivismus und eine politische Bewegung, die den Prozess der Umwandlung der Gesellschaft von einem ungerechten und ungleichen Zustand in einen gerechten und gleichberechtigten Zustand fördert. Social Justice beruht auf der Auffassung, dass jeder Mensch die gleichen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Rechte und Chancen verdient und das Grundrecht hat, sich psychisch und physisch sicher zu fühlen. Social Justice zielt daher darauf ab, geltende Gesetze und gesellschaftliche Normen zu ändern, die in der Vergangenheit und in der Gegenwart bestimmte Gruppen gegenüber anderen unterdrückt haben. Soziale Gerechtigkeit ist nicht nur die Abwesenheit von Diskriminierung, sondern auch das Vorhandensein bewusster Systeme und Unterstützungen, die Gleichheit entlang der Grenzen von Rassifizierung, Geschlecht, Klasse, Fähigkeiten, Religion usw. erreichen und erhalten.
Transgender, oder einfach trans*, ist ein Adjektiv, das sich auf Menschen bezieht, deren Geschlechtsidentität sich von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht unterscheidet. Trans kommt von der lateinischen Vorsilbe, die „hindurch“ oder „darüber hinaus“ bedeutet. Die Selbstbezeichnung gibt als Identitätsmerkmal nicht automatisch an, ob sich diese Person mit einem anderen Geschlecht, keinem Geschlecht oder mehreren Geschlechtern identifiziert. Es gibt also mehrere Trans*-Identitäten. Das Sternchen (*) unterstreicht die Pluralität und Fluidität von Trans-Identitäten.